| Volltext anzeigen | |
181 Elternwunsch: ein „Retterkind“ Die sechsjährige Molly Nash litt an einer angeborenen Blutarmut. Die einzige Rettung bestand in einer Transfusion von Blut eines engen Verwandten. Leider kamen die Eltern nicht als Spender in Frage […]. Daher entschlossen sie sich zur Zeugung eines neuen Kindes durch Invitro-Fertilisation, wobei durch eine PID Embryonen ausgewählt und auf die erforderliche Ge webeverträglichkeit getestet wurden. Schließlich wurde ein Embryo als passender Blutspender ausgewählt und der Mutter eingepflanzt. Kurz nach der Geburt des Jungen Adam Nash wurden ihm Blutzellen aus der Nabelschnur gespült, wo mit das Leben seiner Schwester gerettet wurde. […] Auch wenn dadurch ein Leben gerettet werden konnte, wurde hier die Schwelle zur positiven Eugenik überschritten. Ziel der Auswahl war nicht die Verwerfung kranker Embryonen, sondern die Auswahl eines gesunden „schwes terverträglichen“ Kindes. Der Embryo wurde nicht als ein „Zweck an sich selbst“ betrachtet, sondern als Mittel für einen anderen Zweck instrumentalisiert. nach Thomas Zoglauer, S. 45 A4 a) Erarbeite anhand des Fallbeispiels die verschiedenen Interessen der betroffenen Personen: der Eltern, der kranken Molly und des Bruders Adam, dem sogenannten „Retterkind“. b) Setze dich mit dem Vorwurf des Kritikers auseinander, dass der Embryo nur als Mittel betrachtet wurde. Was zählt ist, ob sie das Kind lieben In einem Gespräch mit der Zeitung Die Zeit berichtet die britische Psychologin Susan Golombok von den Ergebnissen ihrer Langzeitstudie (seit 1985), in der sie im Labor gezeugte Kinder mit normal gezeugten vergleicht. Zeit: Zeigen diese Kinder irgendwelche Auffälligkeiten? Golombok: Wir konnten keine feststellen. […] Zeit: Gilt das genauso für Kinder, die mithilfe 5 10 15 20 einer Samenoder Eizellspende gezeugt wurden? Golombok: Hier existierten zusätzliche Sorgen, weil bei dieser Art der Fortpflanzung einem Elternteil die genetische Verbindung zum Kind fehlt. Dennoch zeigen auch diese Kinder keine sozialen oder emotionalen Auffälligkeiten. Probleme kann aber das Tabu verursachen, das die Samenoder Eizellspende umgibt. Zeit: Inwiefern? Golombok: Wir wissen aus Studien mit Adoptivkindern, dass es für Kinder besser ist, wenn sie ihre Herkunft kennen. Auch Spenderkinder sollten von ihren Eltern über die Umstände ihres Entstehens aufgeklärt werden. Zeit: Klären die Eltern ihre Kinder auf? Golombok: Nur selten. […] Viele Eltern haben Angst, dass ihr Kind sich ihnen entfremdet, wenn es erfährt, dass bei der Zeugung ein Dritter im Spiel war. Doch langsam ändert sich diese Einstellung. […] Die Furcht vieler Eltern, dass ihre Kinder sie weniger lieben würden, ist unbegründet. Je früher man es den Kindern erzählt, desto leichter akzeptieren sie die Wahrheit. Das gilt nach unseren bisherigen Erkenntnissen auch für Kinder, die mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen sind. Zeit: Was wissen wir über das Wohlergehen sogenannter Retterkinder […]? Golombok: […] Wir wissen […], dass die Eltern ihr Kind nicht als Ersatzteillager begreifen, dass sie es lieben wie ihre anderen Kinder auch. Ich vermute, dass die Schwierigkeiten woanders liegen, und zwar bei dem, was die sogenannten Helferkinder durchmachen müssen. Das hängt sehr von der Krankheit ab, unter der die Schwester oder der Bruder leidet. Ob nur die Nabelschnur benötigt wird […] oder gar größere Operationen. Martin Spiewak/Susan Golombok in: Die Zeit, 29.05.2008 A5 a) Erarbeite die Probleme, die bei einem im Labor gezeugten Kind entstehen könnten. b) Was müssen Eltern tun, damit diese Kinder sich normal entwickeln? Neue Technologien Glossar: Embryo, Eugenik, Genetik, Leihmutter Ja! Ne in ! 6645_1_4_2014_kap 5_layout 4 21.10.16 11:41 Seite 181 Nu r z u Pr üf zw ck e Ei ge nt m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
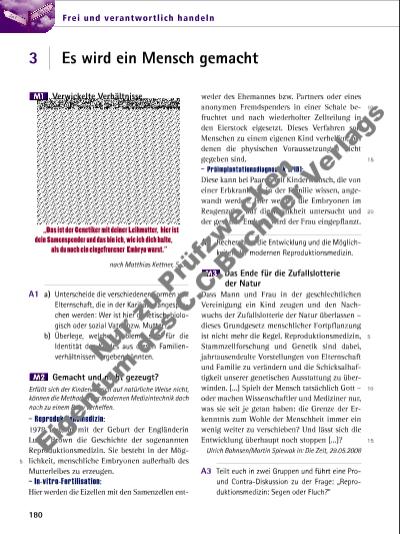 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |