| Volltext anzeigen | |
157Imperialismus und Erster Weltkrieg männliche Arbeitskräfte fehlten oder wo Kriegsgefangene die Lücken nicht schließen konnten. Auch wenn nicht mehr als ein Drittel der Frauen erwerbstätig wurde, bedeutete der Krieg doch für alle einen tiefen Einschnitt: Sie übernahmen die Verantwortung für ihre Familien und erfüllten Aufgaben, die bisher den Männern vorbehalten waren. Der Hunger Am härtesten traf die Zivilbevölkerung die Nahrungsmittelknappheit: Schon 1915 wurden Brotkarten eingeführt. Seit dem Winter 1915/16 gehörte Hunger zum Alltag, vor allem für die, die ihre Nahrungsmittel nicht selbst produzieren konnten. Im „Steckrübenwinter“ 1916/17 waren viele froh, wenn sie sich mit Rüben am Leben erhalten konnten. Etwa 500000 Menschen verhungerten während der Kriegsjahre. Streiks und Demonstrationen Die Geldentwertung (Inflation) vergrößerte Not und Unsicherheit. Sie schritt rascher voran, als die Einkommen stiegen. Der Lebensstandard sank stark. Ursachen waren die von Jahr zu Jahr steigenden Kriegskosten. Die Regierung finanzierte die Ausgaben durch eine enorme Vermehrung des Papiergelds und insgesamt neun Kriegs anleihen bei der Bevölkerung. Der verzweifelte Durchhaltewille wurde über lagert von immer häufigeren Massenstreiks und Friedensdemonstrationen. Überall machte sich Kriegsmüdigkeit breit. Zugleich wuchs in allen Bevölkerungsschichten die Kritik am Monarchen, an der Obersten Heeresleitung und der Regierung. 6 Prothese eines Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg. Die Kriegswirtschaft Der Krieg wurde auch hinter den Fronten geführt. Die Alliierten blockierten die Zufuhr von Rohstoffen ins Deutsche Reich. Die bald spürbare Knappheit etwa an Edelmetallen, Kautschuk, Öl und Baumwolle versuchten die Deutschen durch Ersatzstoffe zu vermindern. Darüber hinaus zog die Regierung alle kriegswichtigen Rohstoffe ein. Glocken wurden von den Kirchtürmen geholt, Eisengitter abmontiert und eingeschmolzen. Die Industrie wurde weitgehend auf die Produktion von Kriegsgütern umgestellt. Die deutsche Reichsleitung forderte, dass „das gesamte Volk sich in den Dienst des Vaterlandes stellt“. In diesem Sinne wurde im Dezember 1916 das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst erlassen. Es sah eine Dienstpflicht für alle Männer von 17 bis 60 Jahren vor. Außerdem mussten etwa 900000 Kriegsgefangene Zwangsarbeit leisten. Der soziale Wandel Selbstständige und Unternehmer zogen aus der Kriegswirtschaft zum Teil beträchtliche Gewinne. Der Abstand zwischen den Reichen und Armen schien immer größer zu werden. Zugleich glichen sich die Arbeiterlöhne und die Angestellten gehälter allmählich an. Vor allem für die Frauen brachte der Krieg einen Wandel. Sie mussten überall einspringen, wo 4 Aufruf zur Kriegsanleihe. Plakat (87 x 57 cm) von 1917. 5 Tote und Verwundete im Ersten Weltkrieg. Gefallene Verwundete Deutsches Reich 1808000 4247000 Frankreich 1 385 000 3044000* Großbritannien 947000 2 122 000 Italien 460000 947000 Österreich-Ungarn 1200000 3620000 Russland 1700000 4950000 Türkei 325000 400000 USA 115 000 206000 * 1,1 Millionen anerkannte Kriegsinvaliden Nach: Der Große Ploetz. Auszug aus der Geschichte, hrsg. vom Verlag Ploetz, Würzburg 352008, S. 780 5Lesetipps: • Rudolf Frank, Der Junge, der seinen Geburtstag vergaß. Ein Roman gegen den Krieg, Weinheim 2001 • Edlef Köppen, Heeresbericht, Berlin 2005 • Iain Lawrence, Der Herr der Nussknacker, Stuttgart 2004 • Inge Meyer-Dietrich, Plascha oder Von kleinen Leuten und großen Träumen, Weinheim 2003 4453_130_161 06.06.14 11:29 Seite 157 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
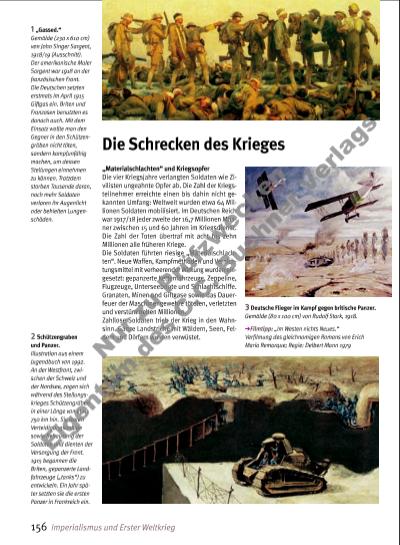 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |