| Volltext anzeigen | |
2152.2 Romanisierung in der Kaiserzeit Umgang des Imperiums mit Kulten und Religionen Im Laufe der Jahrhunderte vermischten sich römische Kultpraktiken mit lokalen Religionen. Nicht nur dem Kaiser, sondern auch den eigenen lokalen Göttern wurde immer stärker auf römische Art und Weise gehuldigt. Vielfach kam es zur Aufnahme fremder Götter anderer Völker in die religiöse Vorstellungswelt der Römer. Während der Kaiserzeit erfreute sich der aus dem Orient stammende Kult des Mithras, eines Gottes des Lichtes, insbesondere beim römischen Heer großer Beliebtheit. Der grundsätzliche offene Umgang der Römer mit Religionen und Göttern wurde durch das Judentum (u M11) und das Christentum infrage gestellt. Da es sich bei ihnen um monotheistische Religionen handelt, verbieten sie anderen Göttern zu huldigen (erstes der Zehn Gebote). Aufgrund dessen lehnten sie es auch ab, die römischen Kaiser als Götter zu verehren. Nachdem Jesus von Nazareth um 30 in Palästina gepredigt hatte, versuchte Rom zunächst, die neue Religion in ihre Glaubensvorstellungen zu integrieren. Die Chris ten aber blieben bei ihrer Intoleranz gegenüber anderen religiösen Ansichten und machten einen Kompromiss unmöglich. So begann Rom in den zwanziger Jahren des 2. Jahrhunderts, das Christentum als Straf tat bestand zu verfolgen. Die seit 250 einsetzenden reichs weiten Christenverfolgungen fanden mit dem Toleranz edikt des Kaisers Galerius (um 250 311) ihr Ende (u M12). Im Jahre 311 hatte dieser das Christentum als Religion erlaubt. Damit tolerierte nun auch Rom eine Religion, die römische Vorstellungen nicht akzeptierte und den Kaiserkult explizit ablehnte. Auf der Gegenseite hatte das Christentum schon lange von seinen Vorstellungen Abstand genommen, das Ende der Welt – und das hieß: das Ende des Imperium Romanum – stünde unmittelbar bevor. Dies führte zu der Auffassung, dass die Verteidigung der bestehenden Ordnung einhergehen konnte mit einem gottgefälligen christlichen Leben. Ein solches Verhalten konnte sich auch auf das vermutlich in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts entstandene Matthäusevangelium (22, 21) berufen: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ Die spätere Integration des Christentums in Herrscherkult und Herrscherpraxis durch Kaiser Konstantin I. (270/288 337) war durchaus auch im Interesse Roms. Er bestätigte 313 im Toleranzedikt von Mailand nicht nur die Anerkennung des Christentums, sondern privilegierte und praktizierte es sogar. Zugleich hielt Konstantin an alten Kultpraktiken fest und wurde nach seinem Tod als Gott verehrt. Gleichwohl bedeutete die sogenannte Konstantinische Wende, dass das Christentum sich von nun an innerhalb des Römischen Reiches massiv verbreiten konnte. Das Christentum kann als Teil der jahrhundertelangen Romanisierungsprozesse betrachtet werden, da es sich seit dem 4. Jahrhundert gerade dank der Strukturen des Imperium Romanum ausdehnen konnte. Gleichzeitig war es den alten römischen religiösen Vorstellungen so fremd, dass die Christianisierung auch zum Ende des Reiches, so wie es viele Jahrhunderte bestanden hatte, beitrug. i Mithras-Kultbild (Ausschnitt). Römisch, um 200. Unter einem Rundbogen mit den zwölf Tierkreiszeichen ist der Gott Mithras mit römischer Tunika dargestellt, wie er einen Stier erdolcht. Blut galt als Quelle des Lebens. Der Mithras-Kult erreichte im Römischen Reich im 2. und 3. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Im 4. Jahrhundert wurde er vom Christentum verdrängt. p Der Mithras-Kult zählt zu den Mysterienkulten (Mysterien: geheime religiöse Feiern). Recherchieren Sie, welche weiteren Mysterienkulte im Römischen Reich existierten. Erklären Sie vor diesem Hintergrund, inwiefern der Kontakt mit anderen Kulturen die religiösen Vorstellungen der Römer veränderte. 32015_1_1_2015_Kap2_204-225.indd 215 01.04.15 10:13 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
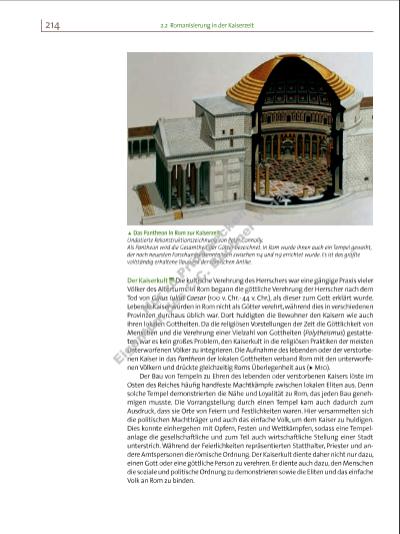 « | 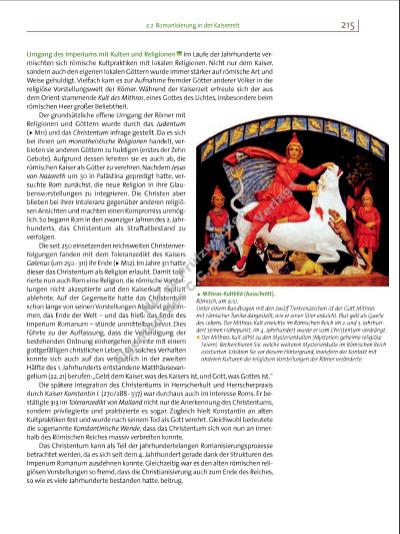 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |