| Volltext anzeigen | |
Auf einen Blick 107 3 4 Absolutistische Wirtschaft: der Merkantilismus Die Gegenwart: Marktwirtschaft in der Globalisierung Durch aufwändige Lebensführung und Prachtentfaltung wollten Fürsten ihre Untertanen sowie andere Herrscher beeindrucken. Die dazu passende Wirtschaftsform war der Merkantilismus. Er ging davon aus, dass der Wohlstand eines Landes an seinem Staatsschatz zu messen sei, den vor allem eine positive Handelsbilanz vermehren könne. Wertvolle Güter sollten im Land geschaffen werden, Werte nicht ins Ausland abfließen. Dazu wurden innere Zölle und Handelsschranken abgeschafft und Verkehrswege verbessert. Fertigund Luxusgüter wurden bei Einfuhr hoch belastet, Rohstoffe gering oder gar nicht. Umgekehrt verhielt es sich bei der Ausfuhr. Zur Vermehrung des Steueraufkommens wurden Ausnahmen abgeschafft und Verbrauchssteuern gefördert. Auch die Vermehrung des Volkes wollte der Fürst fördern. In dieser Zeit entstand auch die Manufaktur, der Typus eines großen Handwerksbetriebs, in dem Fertigprodukte durch Arbeitsteilung und einfache Maschinen zu geringen Kosten erzeugt wurden. Vom Staat bekamen Manufakturen oft ein Marktmonopol zugesichert. Diese Wirtschaftspraxis wurde in Frankreich unter Ludwig XIV. von dessen Finanzminister Colbert durchgesetzt. Auch andere Staaten befolgten sie in unterschiedlichem Maße. Zu ihr gehörten Gewerbeförderung, Flüchtlingsansiedlung und Peuplierung, Einrichtung von Akademien, Protektionismus durch Zölle, Konsumsteuern und Luxusverbote. Insgesamt war diese Politik einer liberalen Wirtschaft unterlegen. Sie förderte einseitig die Interessen der städtischen Gewerbetreibenden und benachteiligte die Landwirtschaft. England und die Niederlande setzten auf geringere Eingriffe in die Wirtschaft und auf Privatinitiative. Ökonomen der Aufklärung begründeten eine liberale Wirtschaftstheorie. Der Schotte Adam Smith lehrte, dass bei freier Entfaltung der Kräfte für alle am Markt Beteiligten das beste Ergebnis erzielt werde („unsichtbare Hand“). Durch Strukturwandel und Freihandelspolitik erhöhte sich nach dem Zweiten Weltkrieg der grenzüberschreitende Güteraustausch beträchtlich. Zölle, Einfuhrquoten und Exportsubventionen wurden durch Handelsabkommen, neue Freihandelszonen und Gemeinsame Märkte abgebaut. Nach dem Untergang des Kommunismus im Ostblock und der ökonomischen Öffnung Chinas sind große Märkte für den Welthandel hinzugekommen. Schrittmacher der Globalisierung sind Großunternehmen, die ihre Produktion in verschiedenen Ländern weltweit betreiben. Globale Konzerne suchen nach günstigsten Standortfaktoren, wozu neben den Kosten auch die Stabilität der Verhältnisse zählt. Länder, die sich dem globalen Markt öffneten, gehörten eher zu den Gewinnern. Wenn sie in den Ausbau der Infrastruktur investieren, können Gesundheit, Qualifikation und Einkommen der Bürger gesteigert werden. Armut in unterentwickelten Staaten ist keine zwangsläufige Folge der Globalisierung, kann aber durch das Handeln von Industriestaaten und Konzernen gefördert werden (Agrarprotektionismus, „Land Grabbing“). Globalisierung führt zur Ausbreitung westlicher Marken und Lebensweisen. Dies wird einerseits als „McDonaldisierung“ kritisiert, verstärkt andererseits aber die Neuentwicklung von Stilen und eine Durchmischung lokaler Identitäten mit globalen Einflüssen. Globalisierungskritiker wie die Aktivisten von Attac betonen die negativen Aspekte, fordern Einschränkungen besonders für die Finanzmärkte und setzen sich für eine gerechte Verteilung der Globalisierungsgewinne ein. Sie kritisieren auch das Unterlaufen von Sozialund Umweltstandards außerhalb der Industriestaaten. In Deutschland hat die Globalisierung unter anderem zur Entstehung eines Niedriglohnsektors und eines Zweiten Arbeitsmarktes geführt. Einkommensunterschiede sind in den vergangenen Jahrzehnten größer geworden. Risiken der globalen Vernetzung wurden deutlich in den weltweiten Finanzkrisen 2007 und 2009, die jeweils von kleinen Ursachen ausgingen und beinahe zum Zusammenbruch ganzer Volkswirtschaften geführt hätten. N r z P rü fz w e c k n E ig e n t m d s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
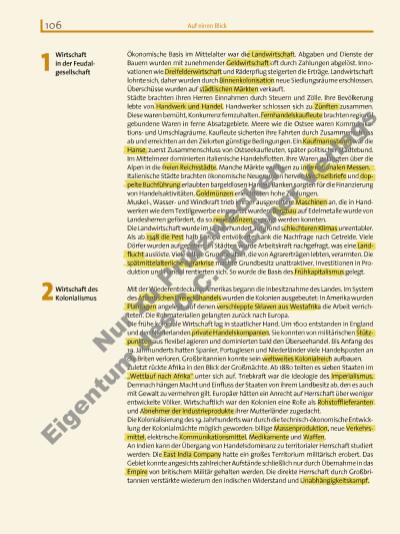 « | 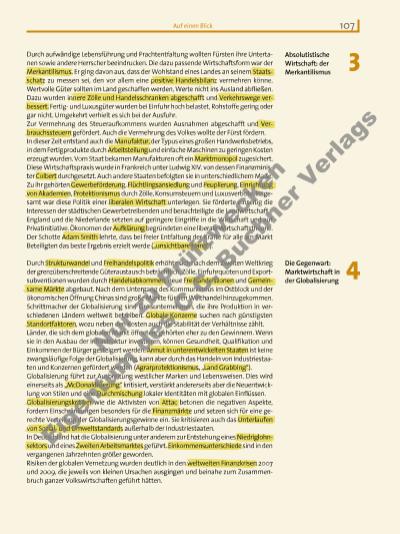 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |