| Volltext anzeigen | |
Restauration: allg. die Wiederherstellung früherer Zustände; speziell der Versuch, nach 1815 die Machtverhältnisse in Europa vor Napoleon bzw. der Französischen Revolution wieder durchzusetzen Neueste Zeit: Demokratisches Gedankengut im 19. und 20. Jahrhundert 41 ein einheitliches Recht eingeführt (Code Civil und andere Gesetzbücher) und die Verwaltung reformiert. Nach dem Untergang der französischen Armee im Russlandfeldzug 1813 wandte sich die deutsche Bevölkerung gegen die französische Fremdherrschaft. Die deutschen Staaten bezwangen in den Befreiungskriegen (1813 1815) zusammen mit anderen Staaten Frankreichs Vormacht in Europa. An den Kämpfen beteiligten sich Freiwillige, meist Studenten, die freiheitliches Denken mit einem deutschen Nationalgefühl verknüpften und für die Einheit des zersplitterten Deutschland eintraten. Die Freiwilligen trugen erstmals als Erkennungszeichen die späteren deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold. Zudem forderten diese Studenten, die sich in Burschenschaften zusammenschlossen, die Beteiligung des Volkes an der Regierung des Staates durch ein Parlament. Ihre zugleich nationalen und liberalen Ideen strahlten auf das Bürgertum ab. Sie gipfelten in der Forderung nach nationalstaatlicher Einigung Deutschlands (nationale Einheit) und politischer Mitwirkung des Bürgertums an der Regierung durch eine Volksvertretung (staatsbürgerliche Freiheit) (u M1). In Bayern gewährte der König der Bevölkerung 1818 eine Verfassung, die seine Rechte beschränkte (konstitutionelle statt absolute Monarchie). Der König behielt jedoch weiterhin die stärkste Position im Staat. Nun konnten aber zumindest die gebildeten und wohlhabenden Männer des Landes im Parlament (bestehend aus zwei Kammern) an der Gesetzgebung und an den Finanzen des Landes mitwirken. Während in der ersten Kammer Adlige, hohe Geistliche und vom König berufene Mitglieder saßen, wurde die „Kammer der Abgeordneten“ nach einem Zensuswahlrecht gebildet. Die Masse der weniger begüterten Männer sowie die Frauen blieben von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen (u M2). Bayern sowie Baden und Württemberg verfügten über die fortschrittlichsten Verfassungen in Deutschland. Der König von Preußen dagegen löste sein während der Befreiungskriege gegebenes Versprechen, den Bürgern eine Verfassung zu geben, nicht ein. Die größte militärische Macht Deutschlands blieb ein vom König und dem Adel dominierter Ständestaat. Die Revolution von 1848/49 und die Paulskirchenverfassung Nach den napoleonischen Kriegen hatten es demokratische Bestrebungen in ganz Europa schwer. Dies traf besonders auf die deutschen Staaten zu. Monarchie und Adel bestimmten die politischen Verhältnisse und bemühten sich, liberale Errungenschaften zurückzudrängen. Staatliche Überwachung und Unterdrückung versuchte in dieser Epoche der Restauration, die nationalen und liberalen Bewegungen zu unterbinden. Viele Bürger zogen sich ins Private zurück. Der angestaute Unmut über die bedrückenden Maßnahmen und über die Tatsache, dass die deutschen Regierungen die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Probleme der Zeit nicht zu lösen vermochten, entlud sich in der Revolution von 1848/49. Angeregt wurde die Volksbewegung von einer revolutionären Erhebung in Frankreich im Februar 1848. Überall in Deutschland trafen sich im März 1848 Bürger in spontanen Volksversammlungen, um ihre Forderungen nach nationalstaatlicher Einheit und politischer Mitwirkung zu erheben. In manchen Städten schoss das Militär auf Demonstranten, in Berlin kam es zu Barrikadenkämpfen mit 270 Toten (u M3). i Die Ermordung Kotzebues. Kolorierter Kupferstich, 1820. Der sehr erfolgreiche Dichter August von Kotzebue war streng anti-napoleonisch und wetterte zugleich gegen Burschenschaften, Turnerbünde und liberale Bestrebungen. Seit 1806 stand er als Diplomat im Dienst des russischen Zaren Alexander I. 1819 wurde Kotzebue von dem radikalen Studenten Karl Ludwig Sand (1795 1820) erstochen. Der Mord war Anlass für eine drastische Einschränkung von Freiheiten in den deutschen Staaten. p Informieren Sie sich über Inhalt und Wirkung der „Karlsbader Beschlüsse“ von 1819. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e tu m d e s C .C . B u c n e r V e rl a g s | |
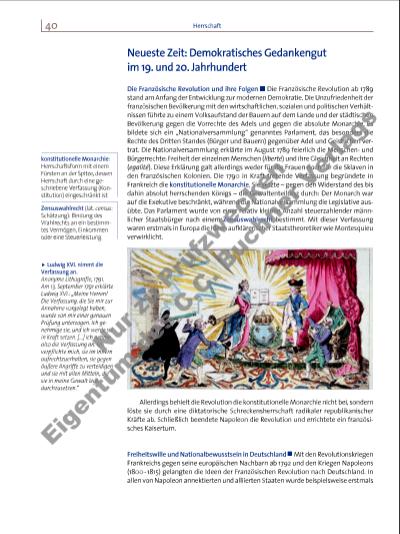 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |