| Volltext anzeigen | |
1 Barackenkolonie in Berlin vor dem Kottbusser Tor auf der Schlächterwiese. Holzstich von 1873. Die „Klein-Amerika“ genannte Siedlung entstand ohne Genehmigung. 1873 wurde sie von der Polizei geräumt, was zu Protesten führte. Das soziale Elend Schon Ende des 18. Jh. waren die Grundherren, Zünfte und Gemeinden nicht mehr in der Lage, den Unterschichten in Krisenzeiten zu helfen. Bevölkerungswachstum, Re for men auf dem Lande (Bauernbefreiung) und Gewerbefreiheit, die mit einer Krise des alten Handwerks einherging, rissen dann im ersten Drittel des 19. Jh. immer mehr Menschen aus ihren überkommenen Ordnungen und lie ßen Massenarmut entstehen. Zeitgenossen bezeichneten dieses soziale Elend als Pauperismus (lat. pauper: arm). Auch die fortschreitende Industrialisierung konnte zunächst nicht genügend Erwerbsmöglichkeiten bereitstellen. Im Ge genteil: Die veränderten Lebensund Arbeitsbedingungen verschärften den Pauperismus zur Sozialen Frage. Sowohl der Staat, die Gemeinden, die Kirchen, das Besitzund Bildungsbürgertum als auch die Handwerker und die Arbeiter selbst suchten nach Lösungen. Der Staat fühlt sich herausgefordert Für den Staat war die Soziale Frage zunächst vor allem eine politische und rechtliche Herausforderung. Denn mit der Not war die Eigentumskriminalität gestiegen und neue Formen des Protests entstanden. Gelegentlich zerstörten Heimarbeiter Maschinen, weil sie diese für ihre Not verantwortlich machten. Dies hatte erstmals der Aufstand der schlesischen Weber von 1844 gezeigt. Dort gab es ein Bündel von Problemen: Umstellung vom Heimgewerbe zur indus triellen Produktion, billige Textileinfuhren aus Großbritannien, Ar beitskräfte überschuss und Miss ern ten. Das führte dazu, dass Frauen und Männer sich bei einzelnen Unternehmern über die schlechte Bezahlung ihrer Heimarbeit empörten. Aus dem friedlichen Protest war ein gewalttätiger Aufstand geworden, an dem sich Tausende von Webern mit ihren Familien beteiligten. Gewalt und Gesetz Die preußische Regierung befürchtete, dass der Aufruhr in eine politische Revolution umschlagen könne. Sie reagierte: Soldaten zogen gegen die Aufständischen. Elf Weber fanden dabei den Tod. Unter den Verletzten befanden sich auch Frauen und Kinder. Über 100 Männer wurden verhaftet, einige erhielten hohe Freiheitsstrafen. Die Regierungen antworteten auf die sozialen Probleme nicht nur mit Gewalt. Unter dem Druck der bürgerlichen Öffentlichkeit begannen sie in den Einzelstaaten bereits in den 1830erJahren, besonders auffallende Missstände durch Gesetze zu verändern. Außerdem setzten sich Staatsbeamte und Bürgermeis ter in Krisenzeiten für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für die Unterschichten ein, z.B. für Schienenund Stra ßen bau . Höhepunkt der staatlichen Versuche, die Soziale Frage zu lösen, bildete 50 Jahre später im Deutschen Reich die gesetzliche Einführung der Kranken-, Unfallsowie Invaliditätsund Altersversicherung nach dem Vorbild bereits bestehender betrieblicher und ge werk schaftlicher Unterstützungskassen.* Wei tere Eingriffe des Staates in die Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel die Festlegung der Arbeitszeit per Gesetz unterblieben aber vor 1918. * Siehe dazu Seite 140 und 142. Wer löst die Soziale Frage? 117 4753_115_127 03.11.16 07:45 Seite 117 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 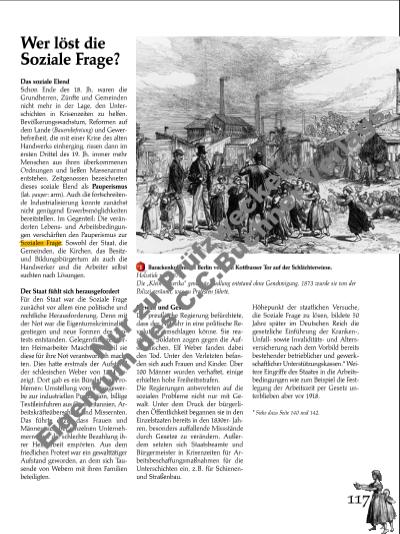 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |