| Volltext anzeigen | |
„Großstadtfaszination“ und „Großstadtkritik“: Entscheiden Sie sich in Partnerarbeit für je eine der beiden Positionen und entwickeln Sie ein Streitgespräch. i Brunnen-Lichthof des Kaufhauses Wertheim in Berlin. Foto von 1906. Im Jahre 1875 eröffneten Abraham und Ida Wertheim in Stralsund das erste Wertheim Kaufhaus: einen kleinen Kurzwarenladen an der Ecke. Die Söhne beteiligten sich am Geschäft, erweiterten das Produktangebot und führten eine Reihe von Neuerungen ein: das Umtauschrecht, einheitliche Preise, Schaufenster und Auslagen, um die Waren vor dem Kauf ausgiebig ansehen zu können. Bereits 1897 war aus dem kleinen Eckladen eine „Warenhauskette“ mit mehreren Filialen geworden, von denen das Gebäude in der Leipziger Straße in Berlin das seinerzeit größte Warenhaus Europas war. Massenkultur und neue Freizeitformen Die Verkürzung der Arbeitszeit, Urlaubsregelungen und die steigende Kaufkraft ermöglichten es immer mehr Menschen, die nach der Arbeit verbleibende Zeit nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. In den Großstädten entstanden neue Tanzlokale, Varietés und Kabaretts. Die Theater bekamen Konkurrenz durch große Revuen mit ihren Gesangsnummern und Tanzeinlagen. Auch der Sport spielte eine immer größere Rolle. 1878 gab es in Hannover den ersten deutschen Fußballverein. 1900 wurde in Leipzig der Deutsche Fußballbund (DFB) gegründet. Seit 1903 fanden Deutsche Meisterschaften statt. Auch Radrennen und Boxkämpfe zogen die Massen an. Zur Freizeit am Wochenende gehörte neben dem Sport für viele Großstädter der Ausfl ug „ins Grüne“, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Massenkultur und neues Freizeitverhalten verwischten die Milieugrenzen zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land. Ins Kino ging der Arbeiter ebenso wie der Großbürger, alle Klassen und Schichten tanzten zu denselben Schlagern und lasen dieselben Illustrierten. Hochund Massenkultur ließen sich nicht mehr eindeutig voneinander trennen. Wachsende Warenwelt und Massenkonsum Durch die technischen Neuerungen und die industrielle Massenfertigung verbesserte sich stetig die Versorgung der Bevölkerung mit neuen Produkten. Dies und die zunehmende Kaufkraft bereiteten der Konsumgesellschaft den Weg. Zigaretten, bislang ein Luxusgut, wurden zu Massenprodukten. Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ersten indus triell gefertigten Lebensmittel wie Fertigsuppen auf den Markt. Zur gleichen Zeit traten Markenartikel dank geschickter Werbung ihren Siegeszug an. Zum herausragenden Zeichen der immer reichhaltigeren Warenwelt wurden die prächtigen Kaufhäuser in den Großstädten. Die ersten faszinierten in Frankreich, England und in den USA schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Kunden. Im Deutschen Reich gewannen Kaufhäuser um 1900 an Bedeutung. Sie boten vor allem Textilien in großer Auswahl und „Kleidung von der Stange“ an, führten feste Preise ein und machten Porzellan, Südfrüchte und Konserven zu Massen artikeln. Die Elektrifi zierung der Haushalte mit Staubsauger, Bügeleisen, Waschmaschine und Kühlschrank wurde zum Inbegriff der modernen Konsum gesellschaft. Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Einkommen konnten sich diesen Luxus allerdings kaum leisten. Der 1928 von der AEG auf den Markt gebrachte „Volksherd“ war jedoch bereits für den Massenkauf konstruiert. Während die Zahl der mit Strom versorgten Haushalte in der Großstadt Berlin zwischen 1925 und 1930 von 27 auf 76 Prozent anstieg, blieben die Kleinstädte und Dörfer auf dem Land noch lange hinter dieser Entwicklung zurück. Dort war von der Konsumund Massengesellschaft bis in die 1930er-Jahre kaum etwas zu spüren. 40 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft 4677_1_1_2015_010-047_Kap1.indd 40 17.07.15 11:36 Nu r z u Pr üf zw e k n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn r V er la s | |
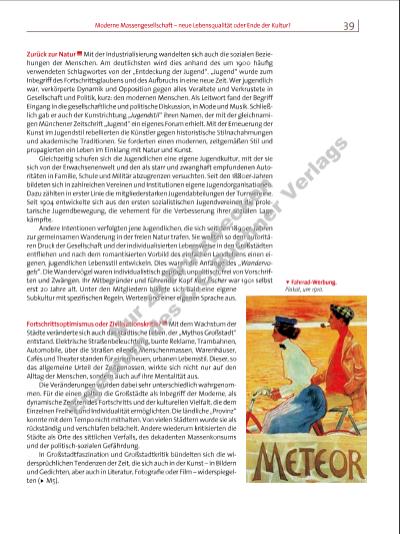 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |