| Volltext anzeigen | |
vielfach gezwungen sehen, zumindest Teile der Produktion in Länder auszulagern, in denen Kostenvorteile bestehen. Bedenklich erscheint, dass in Entwicklungsund Schwellenländern neben einem allgemein niedrigeren Lohnniveau auch niedrigere Sozialund Umweltstandards vorhanden sind. Dies führt insgesamt dazu, dass sich im internationalen Wettbewerb um Standortvorteile auch immer mehr Industrieländer dazu veranlasst fühlen könnten, ihre Standards zu senken. Kritiker sehen im stark zugenommenen Kapitalverkehr ein großes Problem. Anleger versuchen dort ihr Kapital anzulegen, wo sie die höchsten Renditen erzielen können. Das Renditestreben der Anleger führt dazu, dass Manager in Unternehmen immer stärker global denken müssen und auf regionale soziale Gegebenheiten und nachhaltige Produktion weniger Wert legen können. Der weltweite Kapitalmarkt mit seiner großen Zahl an Finanzprodukten ist dabei in den letzten Jahren sehr unübersichtlich geworden, was ursächlich auch zur Finanzkrise 2008 geführt hat. Der weltweit zunehmende Warenverkehr wirkt sich durch die steigenden Abgase negativ auf die Umwelt aus. Die Globalisierung führt über die zunehmende Arbeitsteilung auch zu einem schnelleren Strukturwandel. Viele Arbeitsplätze in Deutschland wurden durch die Globalisierung verlagert. Insgesamt ist die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland aber in den letzten Jahren stark gestiegen, was vermuten lässt, dass Deutschland von der Globalisierung profi tiert. Auch weltweit führt die Globalisierung zu wachsendem Wohlstand. So hat sich nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) das weltweite BIP in den letzten 10 Jahren auf 74 Billionen USDollar verdoppelt. In vielen Bereichen können die Märkte der EU als offen bezeichnet werden. Es existieren also vergleichsweise wenige Handelsschranken. Eine Ausnahme bildet der Agrarsektor. Hier schützt die EU die europäischen Landwirte durch Zollschranken und Subventionen. Um eine Überproduktion bei bestimmten Agrarprodukten zu vermeiden, bestehen auch Mengenkontingente für einzelne Agrarprodukte. Die EU kann im Rahmen der WTO-Grundsätze Zölle und nichttarifäre Handelsschranken (z. B. Mengenbeschränkungen) festlegen. Dies geschieht z. B. als Reaktion auf unerlaubte Handelspraktiken, z. B. bei ruinösem Wettbewerb zu Dumping-Preisen. Die hohen Zollschranken im Agrarsektor treffen auch Entwicklungsländer, die vorwiegend landwirtschaftliche Produkte exportieren. Die EU hat in verschiedenen Bereichen für die ärmsten Staaten der Welt (Least Developed Countries) Zollund Mengenbeschränkungen aufgehoben. Handelspolitisches Verhalten der EU 211 Fachwissen im Zusammenhang 82007_1_1_2015_198_213_Kapitel8.indd 211 15.05.15 12:00 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
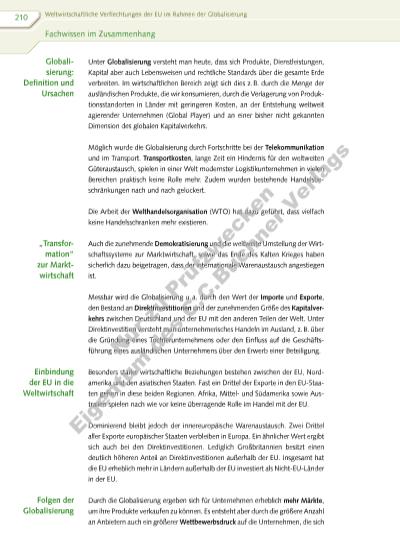 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |