| Volltext anzeigen | |
In diesem Kapitel erwerben Sie die Kompetenz, • das Selbstverständnis und das Weltbild der Chinesen und der Europäer zu charakterisieren, • die Kontakte mit den imperialistischen Mächten und ihre Folgen (u. a. „ungleiche Verträge“, Missionierung, „Open Door Policy“) zu analysieren und zu erläutern, • die Reaktionen auf den imperialistischen Einfl uss (u. a. Selbststärkungsbewegung, Boxeraufstand, Reformansätze) zu interpretieren. Zur Methoden-Kompetenz siehe Seite 256 bis 258 („Statistik“). Zum Kompetenzerwerb im Hinblick auf Theorien und Kontroversen zu Kulturkontakt und Kulturkonfl ikt lesen Sie Seite 248 bis 251 („Theorie-Baustein: Kulturkontakt und Kulturkonfl ikt“) über historische Erklärungsmodelle zu Transformationsprozessen informiert Seite 252 bis 255 („Theorie-Baustein: Transformationsprozess“). Auf einen Blick Bis weit ins 18. Jahrhundert hatte China keine intensiven Beziehungen zum überseeischen Ausland. Das Land war weder Opfer europäischer Eroberungen, noch hatte es selbst überseeische Eroberungen in Angriff genommen. Dies änderte sich im 19. Jahrhundert, da sich die Machtbalance zwischen China und den sich industrialisierenden Ländern in Europa, Amerika und Asien radikal veränderte. China durchlebte im 19. Jahrhundert zahlreiche innenpolitische Krisen und Bürgerkriege, die das Land erheblich schwächten. Gleichzeitig gewannen Großbritannien, Frankreich, Deutschland sowie die USA und Japan aufgrund der Industrialisierung enorme militärische Schlagkraft, die es möglich machte, in China zu intervenieren. Die militärische Überlegenheit Großbritanniens zwang im ersten Opiumkrieg (1839 1842) China dazu, den Briten enorme Handelsvorteile zu gewähren. In späteren Kriegen nutzten Japan, Russland, die USA, Deutschland und Frankreich die militärische Schwäche Chinas, um Teile des Landes zu besetzen oder sich Vorteile im Handel zu verschaffen. Dies bedeutete, dass diese Länder ihre Produkte in China gut verkaufen konnten und es damit dem Land erschwerten, einen eigenständigen Industrialisierungsprozess in Gang zu setzen. Die politischen Kräfte in China entwickelten verschiedene Projekte, um den ausländischen Einfl uss im Land zurückzudrängen. Eine Gruppe von Reformern wollte durch Übernahme ausländischer Praktiken die Industrialisierung im Land befördern und China dadurch stärken. Andere dagegen pochten auf die uralten chinesischen Traditionen und wollten daraus Stärke ziehen. Der Widerstand gegen die imperialistischen Mächte fand auf vielen Ebenen statt. Der größte militärische Aufstand ging als Boxeraufstand in die Geschichte ein (1900). Er wurde von den ausländischen Mächten brutal niedergeschlagen Der Zusammenbruch des Kaisertums und die Einführung der Republik 1911/12 waren nicht zuletzt Folge der Unfähigkeit des politischen Systems Chinas, das Land zu reformieren und gegen äußere Feinde zu verteidigen. Das Ende des Kaisertums brachte aber zunächst nicht die erhoffte Stabilisierung des Landes. Im Gegenteil, China wurde von Aufständen und Bürgerkriegen erschüttert und schließlich teilweise von Japan besetzt. Nach jahrzehntelangen innenpolitischen Auseinandersetzungen, Bürgerkriegen und dem Krieg gegen Japan gelang es schließlich den Kommunisten unter der Führung Mao Zedongs im Jahre 1949, an die Macht zu kommen und dem Land eine stabile politische Ordnung zu geben. Wichtige Namen • Cixi • Guangxu • Mao Zedong • Yuan Shikai • Hong Xiuquan („Tianwang“) Wichtige Begriffe • Boxeraufstand • Bürgerkrieg • Guomindang • Missionierung • „Open Door Policy“ • Opiumkriege • Reform der hundert Tage • Selbststärkungsbewegung • Taiping-Aufstand • „ungleiche Verträge“ 227 32015_1_1_2015_Kap2_226-259.indd 227 01.04.15 10:19 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
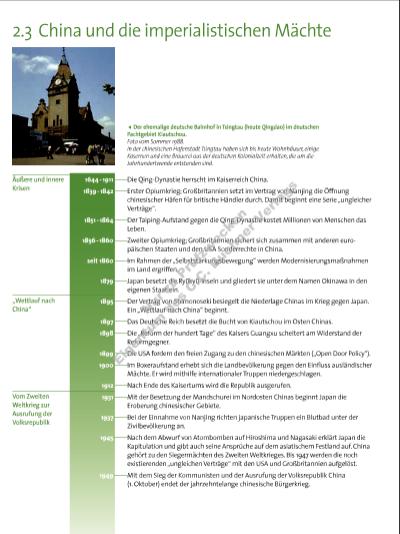 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |