| Volltext anzeigen | |
247Eigennamenverzeichnis Gedichte liefern viele wertvolle Informationen über die Lebensverhältnisse im Gallien des 5. Jh.s) Sīrēnēs, um f Pl. die Sirenen (geflügelte Frauengestalten auf einer Insel vor der italischen Küste, die vorbeifahrende Schiffe mit ihrem unwiderstehlichen Gesang anlockten, um sie dann zu töten; Odysseus und seine Männer konnten ihnen mit Hilfe eines Tricks widerstehen.) Sōl, Sōlis m Sol (röm. Sonnengott, Vater des Phaëthon; griech. Name: Helios) Sophoclēs, is m Sophokles (griech. Tragödiendichter aus Athen, 497–406 v. Chr.; von seinen angeblich 130 Dramen sind sieben erhalten, unter anderem die „Antigone“ und „König Ödipus“. Seine Stücke zeugen von einer tief empfunden Religiosität: Die Götter zwingen dem menschlichen Leben ihre Gerechtigkeit auf, sodass der Weise am besten fährt, wenn er in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen handelt. Geschieht dies nicht, entsteht der tragische Konflikt.) Stōicī, ōrum m Pl. die Stoiker (Anhänger der Stoa, einer philosophischen Strömung, die ca. 300 v. Chr. von Zenon aus Kition gegründet wurde; ihr Grundsatz lautet: Jede Erscheinung und jede menschliche Entscheidung beruhen auf Vernunft und die Natur ist das Vernünftige schlechthin.) (C.) Suētōnius (Tranquillus) Sueton (röm. Schriftsteller, um 70 – um 140 n. Chr., war unter den Kaisern Trajan und Hadrian Sekretär im kaiserlichen Palast, wo er auch zu den kaiserlichen Archiven Zugang hatte. Dies ermöglichte ihm die Abfassung seines biografischen Hauptwerkes „De vita Caesarum“; dieses umfasst die Biografien Cäsars und der röm. Kaiser bis Domitian.) (P. Cornēlius) Tacitus Tacitus (röm. Geschichtsschreiber, um 54 – um 120 n. Chr.; Werke: „Germania“, „Historien“ (Geschichte der Kaiser von Galba bis Domitian), „Annalen“ (Geschichte vom Tod des Augustus bis zur Regierungszeit Neros). Mit Scharfsinn legt Tacitus die Innenwelt seiner Charaktere offen und rückt souverän die bedeutendsten Ereignisse jeder Epoche in den Vordergrund. Er wusste, dass das Kaisertum die bleibende Staatsform sein würde, vertrat jedoch die alte röm. Auffassung, dass der Einzelne entscheidend sei für den Lauf der Geschichte. Aufgabe der Geschichtsschreibung sei es, verdienstvolle Taten aufzu zeichnen, damit die Nachwelt das Laster verachte. Sein Stil ist knapp, prägnant und mitreißend, atmo sphärisch dicht, zuweilen voller Ironie und Sarkasmus.) Tarquinius Superbus Tarquinius Superbus (siebter und letzter König Roms, wurde wegen seiner Grausamkeit 510 v. Chr. gestürzt) Tartarus Tartarus (die Hölle; der Teil der Unterwelt, in dem Verbrecher und Übeltäter nach dem Tod ihre Strafen verbüßen mussten) Terentia Terentia (Ehefrau Ciceros) (P.) Terentius (Āfer) Terenz (röm. Komödiendichter, 185-159 v. Chr.; seine Komödien gehen zumeist auf Vorlagen des Menander zurück und spielen im griech. Bereich; zahlreiche Verse aus Terenz-Stücken wurden sprichwörtlich, z. B. „Quot homines tot sententiae“, „Fortes fortuna adiuvat“, „Homo sum. Humani nil a me alienum puto“. Werke u. a.: „Adelphoe“, „Eunuchus“, „Andria“) (Q. Septimius) Tertulliānus (Flōrēns) Tertullian (ältester lat. Kirchenschriftsteller, aus Karthago, ca. 160–220 n. Chr.; vertrat die christliche Lehre rigoros und übte scharfe Kritik an der heidnischen Kultur. Seine Schriften bilden die Grundlage für Form und Terminologie des theologischen Lateins.) Teutonī, ōrum m Pl. die Teutonen (nordgermanischer Volksstamm, fielen um 115 v. Chr. in Gallien und Italien ein; wurden 102 v. Chr. von den Römern unter der Führung des Konsuls Gaius Marius in Südgallien vernichtend geschlagen) Teutonicus teutonisch, germanisch; Germane Thalēs, is m Thales (griech. Naturforscher, Mathematiker und Philosoph aus Milet, 6. Jh. v. Chr. Im Wasser sah er den Urstoff allen Seins.) Thēbae, ārum f Pl. Theben (Hauptstadt der Landschaft Böotien in Griechenland) Thēseus, eī Theseus (König in Athen, Vater des Hippolytos aus erster Ehe, in zweiter Ehe verheiratet mit Phädra) Thisbē, ēs f Thisbe (Geliebte des Pyramus) Tiberis, is m (Akk. Tiberim) Tiber (Fluss durch Rom) Tiberius (Iūlius Caesar) Tiberius (42 v. Chr.–37 n. Chr., Stiefsohn des Augustus; eroberte als röm. Feldherr weite Teile Nordgermaniens, die 9 n. Chr. in der Varusschlacht wieder verlorengingen; 14–37 n. Chr. röm. Kaiser) Tīrō, ōnis m Tiro (Sekretär Ciceros) Tītān, Tītānis m Titan (Die Titanen waren ein griech. Göttergeschlecht, die Söhne des Uranos (Himmel) und der Gaia (Erde); sie kämpften mit Zeus um die Herrschaft, wurden von diesem nach zehnjährigem Kampf („Titanomachie“) besiegt und in den Tartarus geworfen.) Titus (Flāvius Sabīnus Vespasiānus) Titus (röm. Kaiser von 79–81 n. Chr., Sohn des Kaisers Vespasian; besiegte die Juden 70 n. Chr., eroberte Jerusalem und wurde dafür mit dem noch heute erhaltenen „Titusbogen“ in Rom geehrt. Den Betroffenen des Vesuv-Ausbruches gewährte er großzügig Hilfe. Unter die Bautätigkeit des Titus fallen die Weiterführung und Einweihung des von Vespasian begonnenen Kolosseums und die Titus-Thermen.) (M. Ulpius) Trāiānus Trajan (röm. Kaiser von 98-117 n. Chr., aufgrund seiner außerordentlichen militärischen Verdienste wurde er von Kaiser Nerva adoptiert. Der erhaltene Briefwechsel mit Plinius zeugt von der Menschenfreundlichkeit und Umsicht des Kaisers. Trajan, unter dem das imperium Romanum seine größte Ausdehnung und eine Zeit des Friedens und Wohlstands erlebte, wurde für die Nachwelt zum Idealbild eines guten Kaisers.) Trēverī, ōrum m Pl. die Treverer (gallischer Stamm, der in der Gegend des heutigen Trier siedelte) tribūnus plēbis Volkstribun (zur Zeit der Ständekämpfe geschaffenes Amt, das nur Plebejern zugänglich war. Das Volkstribunat diente zum Schutz der Plebejer vor der Willkür der Patrizier: Ein Veto eines Volkstribunen setzte jegliche MaßNu zu P rü fzw ck e Ei ge tu m de s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 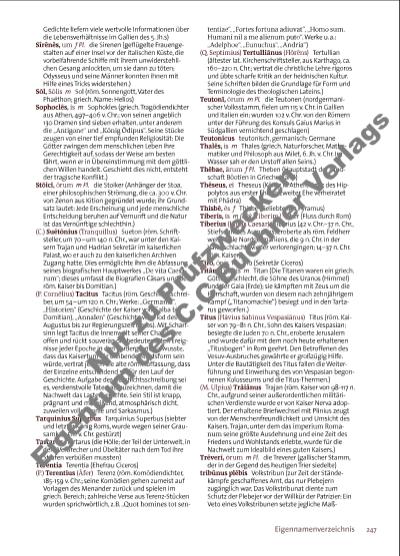 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |