| Volltext anzeigen | |
Was ist Wissenschaft? 109 Später sollte Higgs’ Eingebung an jenem 16. Juli 1964 als einer der Heureka-Momente in die Annalen der Physik eingehen, in denen sich plötzlich ein Geheimnis der Natur dem menschlichen Geist offenbart: Der Brite war auf einen mathematischen Trick gekommen, mit dessen Hilfe sich erklären lässt, warum alle Materiebausteine mit Masse behaftet sind. Higgs selbst allerdings war das seinerzeit keineswegs bewusst. Er glaubte, ein zweckfreies Gedankenspiel zu betreiben. „In diesem Sommer habe ich etwas völlig Nutzloses herausgefunden“, schrieb er kurz nach seiner epochalen Entdeckung an einen seiner Mitarbeiter. Bis heute streiten die Kollegen, wie jener Gedankenblitz zu bewerten sei: War da ein brillanter Denker zu einer Einsicht gelangt, die anderen, weniger genialen Geistern bis dahin verschlossen geblieben war? War Higgs, der nie zuvor von sich hatte reden machen, in einem einzigartigen Moment über sich selbst hinausgewachsen? Oder stimmt, was er in der für ihn so typischen Zurückhaltung einmal über sich selbst sagte: „Wahrscheinlich hatte ich einfach Glück“? Johann Grolle. In: Der Spiegel, 14.10.2013 15 20 25 30 5 10 15 20 1 Ordne die Bilder einzelnen Wissenschaften zu. Stelle eine Liste derjenigen Wissenschaften auf, die dir bekannt sind. ➜ M1 2 Beschreibe die Themen und Methoden in den einzelnen Wissenschaften, soweit sie dir aus den Schulfächern vertraut sind. ➜ M2 3 a) Informiert euch über Peter Higgs sowie andere große Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihre Entdeckungen (s. auch Infoseite S. 110-111). Sammelt Motive und Ziele, die sie angetrieben haben. Welche Rolle spielt das „zweckfreie Gedankenspiel“ für die Wissenschaft? ➜ M3 b) Diskutiert den allgemeinen Nutzen von Wissenschaft und wissenschaftlichen Entdeckungen. Darf Wissenschaft auch nutzlos sein? ➜ M3 4 Erläutere die Theorie wissenschaftlicher Revolutionen anhand der Liste auf der Infoseite (s. S. 110-111). ➜ M4 Wissenschaftliche Revolutionen Die Entwicklung der Wissenschaften lässt sich auf zweierlei Weise betrachten. In der ersten Sicht stellt die Wissenschaft einen stetigen Fortschritt dar. Erkenntnis wird auf Erkenntnis gehäuft, so dass sich das Wissen langsam, aber allmählich vermehrt. In der zweiten Sicht besteht die Entwicklung der Wissenschaften aus Revolutionen. Diese Umbrüche heißen nach dem amerikanischen Wissenschaftsphilosophen Thomas S. Kuhn (1922-1996) Paradigmenwechsel. Als Paradigma wird diejenige wissenschaftliche Auffassung bezeichnet, die zu einer bestimmten Zeit allgemein anerkannt ist. Das gilt zum Beispiel für die klassische Physik, die bis zum Ende des 19. Jahrhundert zur herrschenden Lehrmeinung gehörte. Der Wechsel zu einem anderen Paradigma tritt ein, wenn die frühere Theorie in eine Krise gerät. Das kann durch neue Fakten, Verfahren oder Theorien geschehen, die wiederholt auftauchen und sich nicht mehr abweisen lassen. Um diese neuen Erkenntnisse zu verarbeiten, ist ein weiteres Paradigma erforderlich. Das bedeutet, ein altes Paradigma wird in der Regel nur abgelöst, wenn ein neues Paradigma zur Verfügung steht. M4 A u fg a b e n P R O JE K T Mein Verständnis von Wissenschaft 1. Befragt eure Lehrerinnen und Lehrer, die unterschiedliche Fächer und damit Wissenschaften unterrichten: a) Warum hat die jeweilige Lehrkraft das Fach studiert, das sie jetzt unterrichtet? Was hat sie daran besonders interessiert? b) Wie charakterisiert sie die besondere Eigenart ihres jeweiligen Faches, wie grenzt sie es von anderen Fächern ab? c) Was versteht sie ganz allgemein unter Wissenschaft? 2. Befragt eure Mitschülerinnen und Mitschüler nach ihrem persönlichen Lieblingsfach. Sie sollten ihre Wahl begründen und erläutern, was ihnen daran besonders gefällt. 3. Recherchiert in Gruppenarbeit die Lehrpläne des Sächsischen Bildungsinstituts. Schreibt euch die dort angegebenen Ziele für die einzelnen Unterrichtsfächer heraus. Diskutiert diese Ziele in der Klasse. Nu r z u Pr üf zw c en Ei g nt m C .C . B uc hn r V er la gs | |
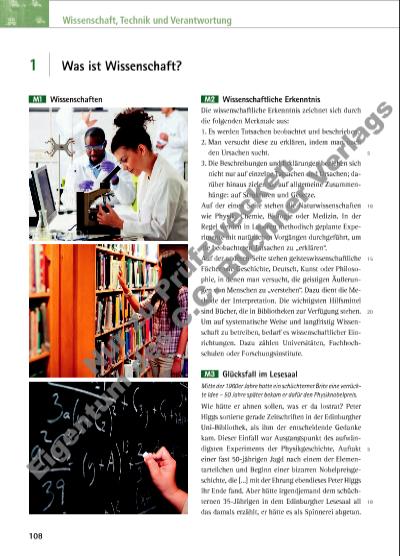 « | 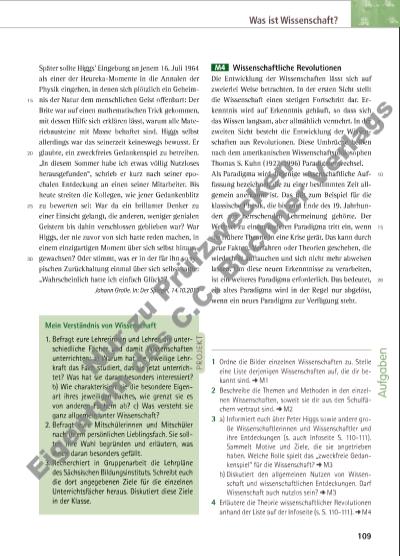 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |