| Volltext anzeigen | |
Auf einen Blick 245 4 5 Krisen und Konflikte: Gesellschaft und Umwelt in China und Japan Ostasien und die Welt: Wirtschafts und Außenpolitik Zwischen der Mehrheit der Han-Chinesen und den verschiedenen nationalen Minderheiten in China flammen immer wieder Konflikte auf. Aufstände der Uiguren, die hauptsächlich in der autonomen Region Xinjiang leben, werden ebenso unterdrückt wie die der mehrheitlich buddhistischen Tibeter. Seit 1959 propagiert das geistliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, aus dem indischen Exil den friedlichen Widerstand gegen die Unterdrückung seines Volkes. Das chinesische Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahrzehnte hat die Sozialstruktur des Landes dramatisch verändert. Einerseits konnten sich Millionen Menschen aus der Armut befreien, sie bilden die stetig wachsende chinesische Mittelschicht. Andererseits steigt auch die Zahl der schlecht bezahlten und vom sozialen Aufstieg ausgeschlossenen ländlichen Wanderarbeiter. Die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich Jahr für Jahr, und auch das Gefälle zwischen Stadt und Land nimmt zu. Hinzu kommt das Problem des demografischen Wandels. Die staatliche Ein-Kind-Politik führt zur Überalterung der chinesischen Gesellschaft – die Versorgung der Alten und der Umgang mit dem prognostizierten Fachkräftemangel sind zentrale Aufgaben für Chinas Zukunft. Auch Japan hat mit der Überalterung seiner Gesellschaft zu kämpfen. Anders als in China gibt es hier jedoch staatliche Nachwuchsförderung und ein umfassendes Rentensystem. Ein weiteres Konfliktfeld liegt in den Umweltschäden, die Chinas rasantes Wirtschaftswachstum nach sich gezogen hat. Verschmutzte Gewässer, fehlendes Trinkwasser, Luftverschmutzung in den Städten, Bodenerosion und Wüstenbildung beeinträchtigen die Lebensqualität von Millionen Menschen. Obwohl die Regierung inzwischen erkannt hat, dass Handlungsbedarf besteht, werden Umweltfragen immer noch wirtschaftlichen Erwägungen untergeordnet. Japan hatte schon seit den 1950er-Jahren mit Umweltverschmutzung zu kämpfen und wurde seit den 1970er-Jahren zu einem Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 war für das Land in dieser Hinsicht ein herber Rückschlag. Bereits in den 1970er-Jahren erlebten die „Tigerstaaten“ Singapur, Hongkong, Taiwan und Südkorea einen Wirtschaftsboom, der sich in erster Linie auf niedrige Lohnund Produktionskosten und eine starke Exportorientierung stützte. Aus westlicher Sicht wirkte dabei verstörend, dass keines dieser Länder demokratisch regiert wurde. Infolge der „Asien-Krise“ von 1997 rutschten die ursprünglichen „Tigerstaaten“, vor allem aber die „Tigerstaaten der zweiten Generation“ (Indonesien, Thailand, Malaysia und die Philippinen) in eine Rezession. Gestützt auf den massiven Export von Billigprodukten ist auch Chinas Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen. Das Wirtschaftssystem der Volksrepublik zeichnet sich heutzutage durch eine aus westlicher Sicht eigenwillige Verschränkung planwirtschaftlicher und kapitalistischer Elemente aus. Um seinen enormen Rohstoffbedarf zu decken, wendet sich China seit Jahren verstärkt nach Afrika. Im Ostund Südchinesischen Meer demonstriert die militärisch aufrüstende Volksrepublik immer wieder ihre Bereitschaft, ihren Einfluss auf rohstoffreiche Gebiete auch gegen die Interessen von Anrainerstaaten auszuweiten. N u r zu P rü fz w e c k n E ig e n tu m s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
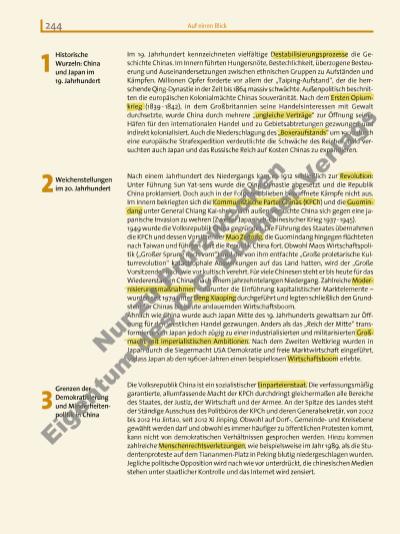 « | 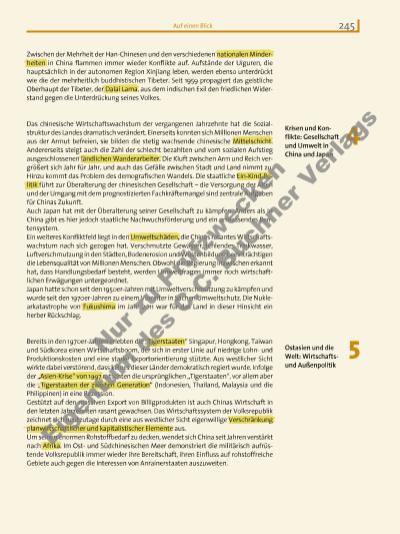 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |