| Volltext anzeigen | |
M6 Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag Der Genfer Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau war einer der wichtigsten Aufklärer. In seinem Werk „Du contrat social“ setzt er sich mit der Gestaltung eines modernen Staates jenseits des damals herrschenden Absolutismus auseinander: Wenn man beim Gesellschaftsvertrag von allem absieht, was nicht zu seinem Wesen gehört, wird man finden, dass er sich auf Folgendes beschränkt: Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns, seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens; und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf. Dieser Akt des Zusammenschlusses schafft augenblicklich anstelle der Einzelperson jedes Vertragspartners eine sittliche Gesamtkörperschaft, die aus ebenso vielen Gliedern besteht, wie die Versammlung Stimmen hat, und die durch ebendiesen Akt ihre Einheit, ihr gemeinschaftliches Ich, ihr Leben und ihren Willen enthält. Diese öffentliche Person, die so aus dem Zusammenschluss aller zustande kommt, trug früher den Namen Polis, heute trägt sie den der Republik […]. Aus dem Vorhergehenden folgt, dass der Gemeinwille immer auf dem rechten Weg ist und auf das öffentliche Wohl abzielt: woraus allerdings nicht folgt, dass die Beschlüsse des Volkes immer gleiche Richtigkeit haben. Zwar will man immer sein Bestes, aber man sieht es nicht immer. Verdorben wird das Volk niemals, aber oft wird es irregeführt, und nur dann scheint es das Schlechte zu wollen. Es gibt oft einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Gesamtwillen und dem Gemeinwillen; dieser sieht nur auf das Gemeininteresse, jener auf das Privatinteresse und ist nichts anderes als die Summe von Sonderwillen: Aber nimm von ebendiesen das Mehr und Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gemeinwille. Wenn die Bürger keinerlei Verbindungen untereinander hätten, würde, wenn das Volk wohlunterrichtet entscheidet, aus der großen Zahl der kleinen Unterschiede immer der Gemeinwille hervorgehen, und die Entscheidung wäre immer gut. Aber wenn Parteiungen entstehen, Teilvereinigungen auf Kosten der großen, wird der Wille jeder dieser Vereinigungen ein allgemeiner hinsichtlich seiner Glieder und ein besonderer hinsichtlich des Staates […]. Um wirklich die Aussage des Gemeinwillens zu bekommen, ist es deshalb wichtig, dass es im Staat keine Teilgesellschaften gibt und dass jeder Bürger nur seine eigene Stimme vertritt. Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag, in: ders., Politische Schriften Bd. 1, übersetzt von Ludwig Schmidt, Paderborn 1977, S. 72 f., 85 ff. 1. Erklären Sie die Entstehung des Staates nach Rousseau. 2. Untersuchen Sie die Theorie Rousseaus nach Individualfreiheiten und Gewaltenteilung. 3. Problematisieren Sie den Begriff des „Gemeinwillens“. 4. Manche Aufklärer sahen im Begriff der Souveränität bei Rousseau ein revolutionäres Prinzip. Beurteilen Sie diese Meinung. M7 Aufklärung – eine Bilanz Der deutsche Historiker Ulrich Im Hof bewertet die Wirkung und Bedeutung der Aufklärung: Die Konservativen schoben die Verantwortung für die Revolution [Französische Revolution ab 1789] der Aufklärung zu, zumindest der Radikalisierung in der zweiten Jahrhunderthälfte [18. Jahrhundert]. Wahrscheinlich sind es eher die Gegenkräfte der Reaktion, der Ewiggestrigen, der Ängstlichen, der Ultrakonservativen gewesen, die nicht rechtzeitig merken wollten, dass man endlich mit tief greifenden Reformen beginnen sollte. Sie haben die Aufgeklärten, die Reformwilligen in die Radikalisierung getrieben. Deren Geduld war überall – nicht allein in Frankreich – zu Ende. […] Im Grunde war die Menschheit durch die Aufklärungsbewegung überfordert worden. Dieses neuartige, starke Licht blendete allzusehr, kam oft allzu rasch und unvermittelt in die barocke Dunkelheit hinein. Eine Elite von Denkern und Aristokraten war der oft naiven Meinung, es genüge der Appell an die ratio, um der Menschheit segensreiche Erkenntnisse schmackhaft zu machen. Es gab zwar Länder und Regionen, wo man damit in der Regel auf Verständnis stieß und wo man ohne harten Bruch die besonders auf sozialem Gebiet notwendigen Reformen vorbereiten und durchführen konnte, in anderen aber war die Aufgabe viel schwerer, und die aufgeklärte Elite war sich in ihrer Ungeduld zu wenig bewusst, welche Widerstände man erst recht aufschreckte. Dennoch bleibt man bis heute beeindruckt von der Summe von Intelligenz, die in diesem Jahrhundert hervorbricht und ohne deren Wirksamkeit ein menschliches Dasein in Dumpfheit und – sagen wir es offen – in Dummheit ungestört hätte weitervegetieren können. Ulrich Im Hof, Das Europa der Aufklärung, Frankfurt am Main/Wien o. J., S. 246 f. 1. Arbeiten Sie Argumente gegen die Aufklärung heraus. 2. Bewerten Sie die Meinung des Autors, die Vertreter des Absolutismus seien für den Ausbruch der Revolution verantwortlich (Z. 4 8). 3. Diskutieren Sie die Ansicht Im Hofs, die Welt wäre ohne Aufklärung „in Dummheit weitervegetiert“ (Z. 27 f.). 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 Frühe Neuzeit: Neue Menschenund Weltbilder 37 N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a s | |
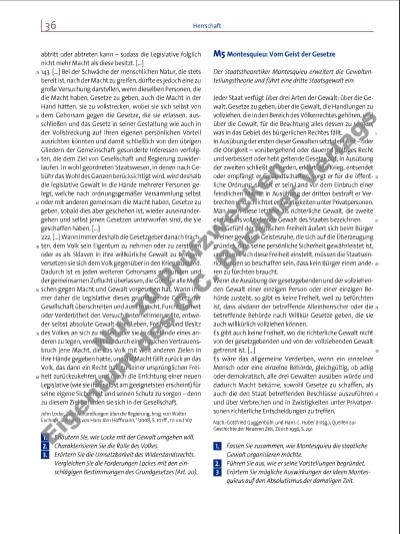 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |