| Volltext anzeigen | |
Auf einen Blick 73 Mägde waren untergeordnet. Die Familien funktionierten als Hausund Wirtschaftsgemeinschaft. In ländlichen Gebieten bestand dieses Modell noch bis ins 20. Jahrhundert fort. Im hohen Mittelalter (11./12. Jh.) setzte sich die Konsensehe als gängige Form der Heirat durch. Ehen schloss man aus freiem Willen, jedoch nicht ohne die Einwilligung von Eltern, Hausoder Grundherrn. Homosexualität, Polygamie sowie vorund außerehelicher Geschlechtsverkehr waren streng untersagt, Scheidungen nur sehr selten möglich. Das Erbrecht galt nur für männliche eheliche Nachkommen. Mädchen und uneheliche Kinder waren stark benachteiligt. In vorindustrieller Zeit zählten Kindheit und Jugend nicht als eigenwertige Lebensabschnitte. Materieller Mangel und hohe Sterblichkeit machten das Überleben zum obersten Gebot. Die berufliche Zukunft lag im Ermessen der Eltern oder Herren. Berufswahl und beruflicher Aufstieg waren stark eingeschränkt. Erst im 17. und 18. Jahrhundert erhielt Arbeit einen höheren Stellenwert als Teil der Identität jedes Menschen. Die Industrialisierung brachte große Umwälzungen für den Alltag. In den Städten wurden Arbeitsund Privatleben zu getrennten Bereichen. Der Beruf fand außerhalb des Hauses statt, das Eigenheim blieb dem Wohnen, der Partnerschaft und Kindererziehung vorbehalten. Gleichzeitig erfolgte eine Trennung der Geschlechterrollen: Männer gingen zur Arbeit, Frauen blieben im Haushalt. Die Familie wurde zum Rückzugsraum von der Öffentlichkeit. In der „häuslichen“ Privatund Intimsphäre galten Liebe und Harmonie als höchste Werte. Vorreiter dieser Lebensweise war das Bürgertum. Für die Arbeiterfamilien herrschten lange Zeit zu schwierige Bedingungen für ein bürgerliches Leben. Die bügerliche Geschlechtertrennung wurde zusehends fragwürdig. Im 20. Jahrhundert erreichte die Frauenbewegung nach und nach die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau in Ehe, Bildung und Berufsleben. Neben den Geschlechterrollen wandelte sich auch die Grundhaltung der Menschen, ihre Mentalität. Individuelle Ansprüche und Ziele traten in den Vordergrund. Die Gesellschaft wurde zur Konsumgesellschaft, auch dank immer besserer materieller Versorgung. Langfristig änderte sich das generative Verhalten. Kinderwunsch und Kinderzahl lagen nun im Ermessen der Ehepartner und wurden bewusst geplant (Familienplanung). Wenige Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg verbreiteten sich Wohlstand und soziale Sicherheit in der westlichen Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund gewannen postmaterielle Werte wie Frieden, Gerechtigkeit und persönliche Entfaltung mehr Bedeutung. Dieser Wertewandel führte zu einer Aufwertung von Kindheit und Jugend, zu neuen Erziehungspraktiken sowie zu mehr Toleranz. Ganz allgemein nahm der Wert des eigenen Lebens zu: Individuelle Lebensentwürfe und Berufskarrieren sind inzwischen üblich und dienen im Idealfall der persönlichen Entfaltung („Selbstverwirklichung“). Gleichgeschlechtliche Partnerschaften und „Ehen ohne Trauschein“ gelten heute als normal. Dank steigender Lebenserwartung haben die Menschen eine lange Lebensperspektive und können (oder müssen) für ein hohes Alter planen. Im Industriezeitalter spielen Massenmedien und Telekommunikation eine immer größere Rolle. Über das Internet sind Soziale Netzwerke entstanden, die Menschen aus aller Welt miteinander verbinden. N u r zu P rü fz w e k n E ig n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
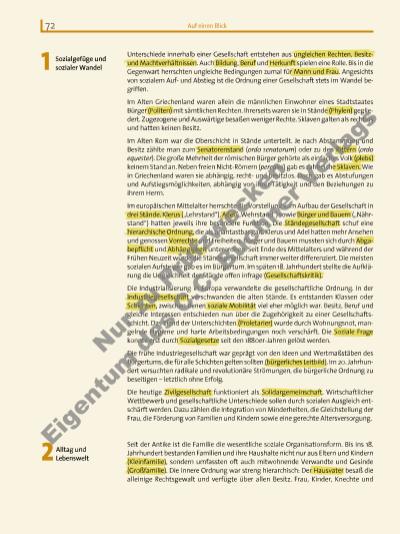 « | 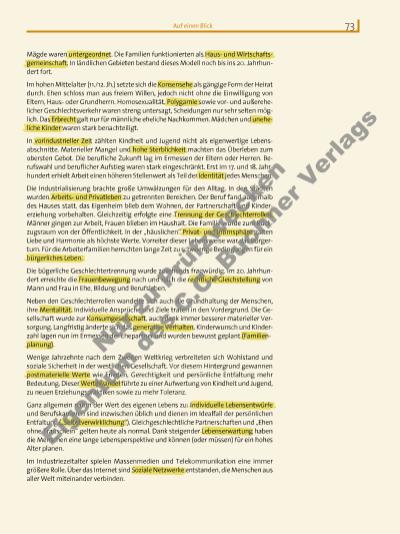 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |