| Volltext anzeigen | |
Obwohl die internationale Arbeitsteilung und der Freihandel – in der Theorie – für alle beteiligten Länder vorteilhaft sind und zu größerem Wohlstand führen, bauen einige Länder immer wieder Handelshemmnisse auf. Dieser sog. Protektionismus will die inländische Wirtschaft vor der ausländischen Konkurrenz schützen. Das Ziel des Protektionismus ist es, die Exporte der heimischen Unternehmen zu fördern und Importe aus dem Ausland zu beschränken. Man erhofft sich durch diese Politik die Güterproduktion der inländischen Wirtschaft zu erhöhen, wodurch das BIP steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt und die Steuereinnahmen für den Staat steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zum Schutz der inländischen Wirtschaft tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse aufgestellt. Tarifäre Handelshemmnisse, d. h. die Erhebung von Zöllen auf ausländische Importwaren, sind das klassische Instrument des Protektionismus. Diese Zölle verteuern den Preis der importierten Güter und diese können im Wettbewerb mit den inländischen Waren nur noch schwer konkurrieren. Der Absatz der heimischen Güter hingegen steigt. Die Erhebung von Zöllen ist jedoch eine sehr offensichtliche Maßnahme einer protektionistischen Handelspolitik. Deshalb greifen viele Länder inzwischen eher zu den versteckteren Methoden der nicht-tarifären Handelshemmnisse. Diese greifen nicht auf Zölle zurück, sondern sind Maßnahmen, die auf indirektem Weg den Import begrenzen bzw. die Exporte fördern. Hierzu zählen beispielsweise: Zwang zu Kompensationsgeschäften, d. h. ein ausländischer Lieferant muss sich seinerseits verpflichten, inländische Waren in vorher festgesetzter Höhe zu kaufen. Staatliche Auflagen bzw. Produktnormen, d. h. die ausländische Konkurrenz wird verpflichtet gewisse Standards zu erfüllen, die jedoch oft unverhältnismäßig hoch gesetzt werden. Mengenrestriktionen, d. h. ein Land erlaubt nur den Import einer bestimmten Quote bzw. eines begrenzten Kontingents ausländischer Waren. Der Protektionismus läuft jedoch dem Leitbild des Freihandels vollkommen zuwider und geht zu Lasten des Auslands, das weniger Waren exportieren kann. Die anderen Länder reagieren auf protektionistische Maßnahmen, indem sie wiederum selbst Handelshemmnisse aufbauen, um ihre Wirtschaft zu schützen. Ein sog. Handelskrieg bricht aus und der Welthandel, der ja für alle beteiligten Länder – in der Theorie – vorteilhaft ist, kommt immer mehr zum Erliegen. Deshalb wird der Protektionismus im Allgemeinen als sehr kurzsichtige und eigensinnige Politik angesehen und wird von der Weltgemeinschaft abgelehnt. Die WTO (Welthandelsorganisation; engl.: World Trade Organization) ist deshalb bestrebt, die tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse abzubauen und setzt sich für eine Liberalisierung, d. h. für eine zunehmende Öffnung, des Welthandels ein. Protektionismus 165 Fachwissen im Zusammenhang 82002_1_1_2015_148_167_Kapitel6.indd 165 15.05.15 11:19 Nu r z u P üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
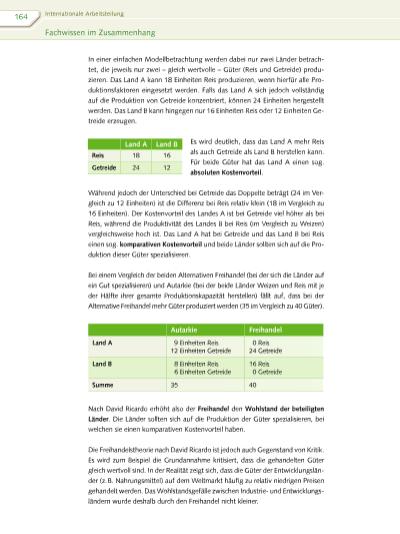 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |