| Volltext anzeigen | |
297 Sozialismus: Wirtschaftsordnung, in der der Staat alle Produktionsmittel verwaltet. Nach der Lehre des k Kommunismus ist der Sozialismus die Vorstufe zur staatsund klassenlosen Gesellschaft. Sozialistengesetz: Von 1878 bis 1890 gültiges Ausnahmegesetz zur Unterdrückung der Arbeiterbewegung. Es verbot alle k sozialdemokratischen Vereine, Versammlungen oder Schriften. Ständeordnung: Die mittelalterliche Gesellschaft war in drei Stände gegliedert: Adel, Klerus und k Dritter Stand. Sie unterschieden sich durch Abstammung, Vorrechte, Pfl ichten, Beruf und Lebensstil. Verfassung: Satzung, die die politischen Rechte und Aufgaben von Monarchen, Ständen und k Bürgern festlegt. Völkerwanderung: Seit 300 n. Chr. drangen germanische Völker gewaltsam ins Römische Reich ein oder durften sich friedlich darin niederlassen. Sie gründeten eigene Reiche und trugen zum Zerfall des Weströmischen Reiches bei. Das mächtigste germanische Reich wurde das k Frankenreich. Wiener Kongress: 1814/15 versammelten sich die europäischen Mächte in Wien, um in einer neuen Friedensordnung das Gleichgewicht der Staaten auf dem Kontinent und die Macht der Fürsten wiederherzustellen. Ritter: Sie leisteten Waffendienst zu Pferde und gelobten ihrem Herrn (dem König oder einem Fürsten), christlich, tapfer, treu und gerecht zu sein. Minnesänger erzählten in ihren Liedern, wie die Ritter die Frauen verehrten. Souveränität: Selbstbestimmung. In der Politik wird die Person bzw. Gruppe, die im Staat die Macht ausübt, als „Souverän“ bezeichnet. Die k Aufklärung forderte die Souveränität des Volkes („Volkssouveränität“). Sozialdarwinismus: Bezeichnung für eine nur scheinbar wissenschaftliche Lehre, bei der die Evolutionstheorie von Charles Darwin in den 1870er-Jahren auf die menschliche Gesellschaft übertragen wurde. Demnach kämpfen die Rassen um das Überleben und nur die angeblich überlegenen setzen sich durch. Mit dem Sozialdarwinismus wurden der k Imperialismus und der k Antisemitismus gerechtfertigt. Sozialdemokratie: Teil der organisierten Arbeiterbewegung. Sie setzte sich für das allgemeine Wahlrecht, für menschenwürdige Lebensund Arbeitsbedingungen und für eine gerechte Verteilung der Güter an alle ein. Seit 1890 ist sie in der „Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (SPD) organisiert. Soziale Frage: Die k Industrialisierung führte zu Massenelend in der Arbeiterschaft. Dieses Problem wird Soziale Frage genannt. Sozialgesetzgebung: schrittweise Einführung einer Kranken-, Unfallund Altersversicherung im Deutschen Kaiserreich (1883-89). Arbeitgeber und Arbeiter zahlen gemeinsam die Beiträge. Das Grundprinzip der Sozialversicherungen gilt noch heute. Später kamen noch weitere Sozialversicherungen hinzu, die Arbeitslosenversicherung (1927) und die Pfl egeversicherung (1995). Oktoberrevolution: Sturz der bürgerlichen Regierung 1917 in Russland. Die Bolschewiki übernahmen die Macht und errichteten eine Diktatur. Sie verstaatlichten schrittweise die Produktionsmittel, um eine k sozialistische Wirtschaftsordnung zu errichten. Russland nannten sie später die „Union der sozialistischen Sowjetrepubliken“ (UdSSR) oder kurz Sowjetunion. Diese Staatsordnung endete 1991. Patrizier: Oberhäupter der reichen Familien in der mittelalterlichen Stadt, zumeist Kaufl eute (so genannt nach der Oberschicht im antiken Rom). Aus ihrem Kreis wurden die Ratsherren der Stadt gewählt. Pfalz: Aufenthaltsort für den reisenden Herrscher, mit einem palastartigen Wohngebäude und einer Kirche; Stützpunkt der königlichen Verwaltung und Herrschaft. Reformation: von k Martin Luther ausgehende Bewegung, die Kirche und Glaube erneuern wollte. Sie endete in der Spaltung der katholischen Kirche in verschiedene christliche Konfessionen. Reichstag: demokratisch gewähltes Parlament im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik (19181933). Erst ab 1918 durfte der Reichstag die Regierung kontrollieren. Renaissance (frz.: „Wiedergeburt“): Gemeint ist die Wiedergeburt der antiken Kunst und Kultur (etwa 1300-1600). Gelehrte und Herrscher wollten das Wissen und die Kunst der Antike nutzen und weiterentwickeln. Restauration (lat. restaurare: wiederherstellen): Wiederherstellung früherer, oft durch eine Revolution beseitigter politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse. So genannt wird auch die Epoche in der Zeit von 1815 bis 1848, in der die Fürsten versuchten, alle nationalen und liberalen Bestrebungen zu unterdrücken. N u r zu P ü fz e c k e E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
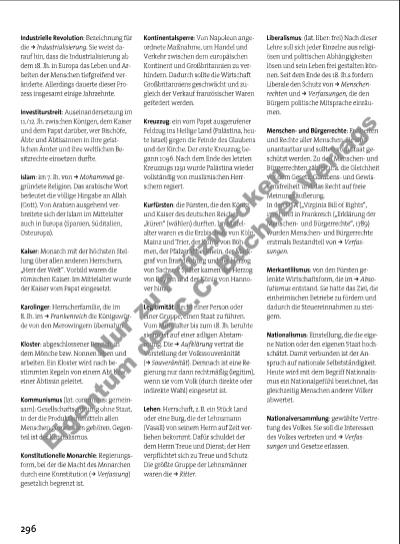 « | 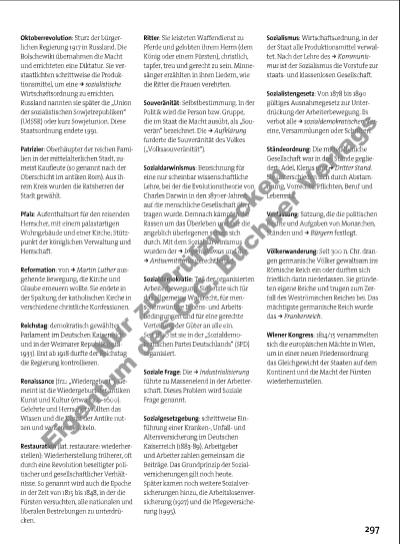 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |