| Volltext anzeigen | |
147 turgetreu abzubilden. Ein Höhepunkt dieses Naturalismus ist das Drama „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann. Es zeichnet die Schattenseiten der Indus tria lisierung genau nach. Die konservativen Vertreter der Wilhelmi nischen Gesellschaft lehnten die Werke der Naturalisten als „Rinnsteinliteratur“ ab. Die Impressionisten Gegen den Widerstand bürgerlicher Kreise gewannen vor der Jahrhundertwende franzö sische Künstler wie Claude Monet, Auguste Renoir und Edgar Degas Einfluss auf die deutsche Malerei. Diesen von vielen als „Farbkleckser“ verhöhnten Künstlern ging es nicht darum, die Wirklichkeit abzubilden. Sie wollten den Eindruck, die Impression, eines bestimmten Augenblicks festhalten und versuchten den Einfluss des Lichts auf die Natur und den Menschen sichtbar zu machen. Max Liebermann, Lovis Corinth und Max Slevogt wurden die bedeutends ten deutschen Impressionisten. Vom Kubismus zur Abstraktion Nachdem Einstein neue Dimensionen für Zeit und Raum erkannt hatte, begannen einige Maler die bisher vertraute perspektivische Einheit von Körper und Raum teilweise oder ganz aufzulösen. Der Katalane Pablo Picasso, der zum überragenden Maler in der ersten Hälfte des 20. Jh.s werden sollte, zerlegte in seinen frühen Bildern die Gegenstände in vereinfachte geometrische Teile und Ebenen (so genannte „Kuben“: Würfel) und prägte damit den Kubismus. Die Aufhebung der bisherigen Zentralperspektive und des dreidimensionalen Raums führte zum Verzicht auf Bild elemente, die der äußeren Wirklichkeit entstammten. Diese Lösung vom Gegenständlichen und die starke Vereinfachung der Formen nennt man Abstraktion. 1910 malte der Russe Wassily Kandinsky in München das erste abstrakte (gegenstandslose) Aquarell. Seine Arbeiten bildeten nicht mehr das ab, was zu sehen war, sondern schufen durch ihre Farben und Linien neue (Kunst-) Wirklichkeiten. Wie die moderne Physik unsichtbare Strahlen nutzte, die Psy choanalyse das Unbewusste der See le aufdeckte, so versuchte die moderne Kunst nun, „Unsichtbares“ wie Gefühle sichtbar zu machen. Expressionistische Kunst Eine Richtung der modernen Kunst nannte man wegen ihres leidenschaftlichen Strebens nach Ausdruck und innerer Wahrheit Expressionismus (Ausdruckskunst). Sie ging ab 1905 von kleinen Gruppen aus und erfasste nach 1910 alle Künste: Malerei, Bildhauerkunst, Literatur, Tanz, Musik und Schau spielkunst, später auch Film und Architektur. Zu ihrer Zeit waren expressionistische Maler wie Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Literaten wie Georg Trakl und Georg Heym unbeliebte Außenseiter. 3 Weberzug. Radierung (21,7 x 29,3 cm) von Käthe Kollwitz, 1897. Nachdem die 30-jährige Künstlerin das Drama „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann gesehen hatte, griff sie das Motiv der leidenden, aufständischer und schließlich unterliegenden Weber in ihrer Bilderfolge „Ein Weberaufstand“ auf. 1898 verweigerte Wilhelm II. der Künstlerin wegen dieser Bilder eine bereits zugespro chene Auszeichnung. Bilder zur Erbauung Zahlreiche Künstler ließen sich nach der Gründung des Reiches in den Dienst der staatlichen Kulturpolitik nehmen. Besonders zeigte sich dies in der Malerei. Sie diente vor allem der Erbauung, huldigte dem Herrscherhaus und verherrlichte die Nation. Ihr einflussreichs ter Vertreter war der Historienmaler Anton von Werner, der seit 1875 die Hochschule für bildende Küns te in Berlin leitete*. Gegen die idealisierende oder romantisierende Malerei entwickelte sich ein realistischer Stil. Die Alltagswelt und der arbeitende Mensch wurden Gegenstand der Kunst. Bilder von Adolph von Menzel ** oder Käthe Kollwitz zeugen davon. Dichter entdecken die Wirklichkeit Auch in der populären Literatur der Reichsgründungszeit waren römische und mittelalterliche Kriegsgeschichten sowie germanische Heldensagen beliebte Themen. Von diesem „patriotischen Radau” setzten sich Schriftsteller wie Wilhelm Raabe und Theodor Fontane mit ihren Novellen und Romanen ab. Sie bevorzugten realistische Stoffe aus der Alltagswelt, über die sie nicht einfach berichteten, sondern die sie poetisch gestalteten. Sowohl gegen diesen „poetischen Realismus“ als auch gegen die Heldenliteratur richtete sich der Versuch einiger Dichter, die Wirklichkeit möglichst na* siehe Abb. 2, Seite 123. ** siehe Seite 116 f. 4743_145_160_q7.qxd 12.08.2016 8:09 Uhr Seite 147 Nu r z u Pr üf zw ec ke n E g nt um d es C .C .B ch ne r V er la gs | |
 « | 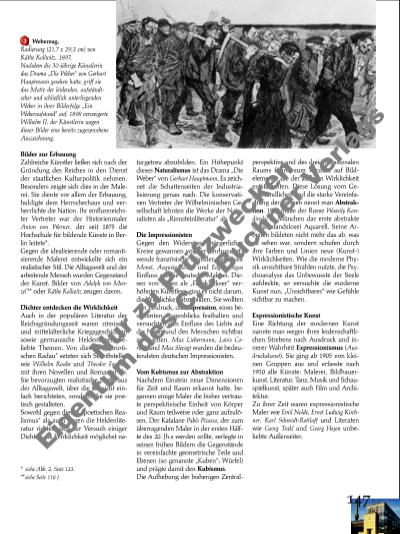 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |