| Volltext anzeigen | |
„Streben nach Glück“ Die Kolonien erarbeiteten bereits während des Krieges eigene Verfassungen. Die erste von ihnen, die „Virginia Bill of Rights“ vom 12. Juni 1776, setzte die Staatslehre der europäischen Aufklärer um: Sie enthielt erstmals eine Liste von Menschenrechten, legte darüber hinaus die Gewaltenteilung, die regelmäßige Wahl der Abgeordneten nach einem Zensuswahlrecht für Männer, die Einberufung von Geschworenengerichten, Presseund Religionsfreiheit sowie das Recht auf Widerstand fest. Diese Verfassung beeinfl usste die folgende inneramerikanische und europäische Verfassungsentwicklung maßgeblich. Von ebenso weitreichender Bedeutung erwies sich die am 4. Juli 1776 verkündete Unabhängigkeitserklärung (Declaration of Independence). Sie war in einem Ausschuss des Kontinentalkongresses von Thomas Jefferson entworfen worden. Entscheidenden Einfl uss nahm der Journalist Thomas Paine mit seiner Streitschrift „Common Sense“ (Gesunder Menschenverstand), mit der er die Abgeordneten des Transkontinentalkongresses endgültig davon überzeugte, die vollständige Unabhängigkeit von England anzustreben (u M2). In der „Declaration of Independence“ erklärten die Abgeordneten die Herrschaft des englischen Königs zur widerrechtlichen Tyrannei. Aufgabe jeder Regierung sei es, allen Menschen die „gleichen, unveräußerlichen, natürlichen Rechte“ auf „Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ (pursuit of happiness) zuzubilligen (u M3). Identität in Urkundenform Am 25. Mai 1787 kamen die 55 Delegierten des Kontinentalkongresses aus zwölf Staaten in Philadelphia zusammen und arbeiteten unter dem Vorsitz von Washington auf der Grundlage der 1781 ratifi zierten Konföderationsartikel einen neuen Verfassungsentwurf aus. Der Entwurf, den sie am 17. September 1787 verabschiedeten, sah einen föderativen Staatenbund mit einer republikanischen Verfassung und einem starken Präsidenten an der Spitze vor. Die Bundesverfassung nahm den Einzelstaaten von ihrer Souveränität nur so viel, wie der Staatenbund brauchte, um den Handel im Innern zu ordnen und die Nation nach außen wirkungsvoll zu vertreten und zu schützen. Sie schuf dazu ein System der Gewaltenteilung und wechselseitigen Kontrollen (checks and balances). Die Regelung des Wahlrechts blieb weitgehend den Einzelstaaten überlassen. Frauen, Sklaven und Ureinwohner hatten kein Recht zu wählen, zudem schloss das Zensuswahlrecht überall den größten Teil der Bevölkerung von den Wahlen aus. Bis 1788 hatten die meisten Staaten die Bundesverfassung angenommen, und im Februar 1789 wurde George Washington zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Während seiner Regierungszeit nahm der Kongress die Bill of Rights als Verfassungszusätze (amendments) in die Bundesverfassung auf. Die Stellung der Frau in Politik und Gesellschaft sowie das Problem der Ungleichbehandlung der afroamerikanischen Sklaven blieben noch unberücksichtigt, obwohl entsprechende Forderungen bereits bestanden. Insgesamt garantierte die Verfassung mit den „amendments“ jedoch Rechte und Freiheiten, von denen die Europäer zu dieser Zeit nur träumen konnten. Die Annahme der Verfassung und die Bildung der ersten Bundesregierung schlossen eine außerordentliche Entwicklung ab: Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft hatten gemeinsam gegen den Herrschaftsanspruch eines Königs gekämpft, um in einem eigenen Nationalstaat zu leben. Die Landnahme, der siegreiche Kampf um die Unabhängigkeit und der erfolgreiche Zusammenschluss zu einem souveränen, demokratischen Staat lasen sich in den Augen der Amerikaner als eine nationale Erfolgsgeschichte (u M4). Sie ließ aus dem puritanischen Glauben, „Auserwählte“ zu sein, die Überzeugung entstehen, Amerika sei eine „auserwählte Nation“, deren zukünftige Aufgabe darin bestehe, ihre Werte überall dort durchzusetzen, wo sie nicht galten. Zensuswahlrecht: Wahlsystem, bei dem das Wahlrecht an den Nachweis von Besitz, Einkommen oder Steuerleistung (Zensus) gebunden ist. Das allgemeine Männerwahlrecht wurde in den USA 1830 eingeführt. Thomas Paine (1737 1809): englischer Journalist und Politiker; emi grierte 1774 nach Amerika, wurde Aktivist im Kampf gegen die Sklaverei; 1776 Veröffent lichung seiner Schrift „Common Sense“, die in kurzer Zeit zwölf Aufl agen erlebte und die öffentliche Meinung sowie schließlich die Unabhängigkeitserklärung entscheidend beeinfl usste. Paine gilt als einer der geistigen Gründerväter der USA. Thomas Jefferson (1743 1826): Rechtsanwalt aus Virginia; nach der Unabhängigkeit der Vereinigten Kolonien 1785 1789 amerikanischer Gesandter in Frankreich, 1789 1794 Außenminister und 1801 1809 der dritte Präsident der USA 177Die Ausbildung des US-amerikanischen Selbstbewusstseins Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
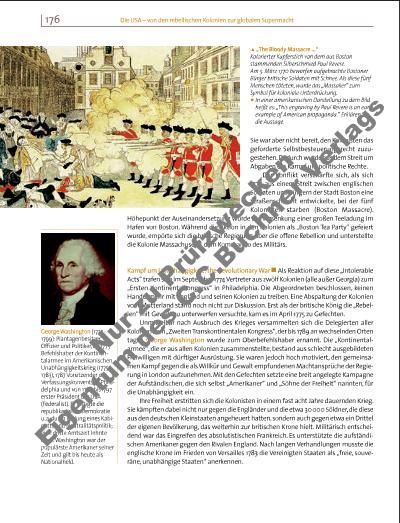 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |