| Volltext anzeigen | |
Vorbild England Die englischen Kolonien fühlten sie sich als Teil des Empire und standen loyal zur Krone. Verwaltung, Rechtsprechung, Wirtschaft und Kultur orientierten sich am englischen Vorbild. Mit zunehmender wirtschaftlicher Bedeutung wuchs Englands Interesse an den nordamerikanischen Kolonien. Sie sollten dem Mutterland als Absatzmärkte und Rohstoffl ieferanten dienen. Um mehr Kontrolle über die Kolonien zu erlangen, ersetzte der König die bis dahin frei gewählten Gouverneure durch seine Beamten. Politische Mitbestimmungsrechte waren – wie in England – an Bedingungen wie Eigentum, Steueraufkommen und Aufenthaltsdauer gebunden. Ärmere Bürger, Frauen und Sklaven blieben von der politischen Entscheidungsfi ndung und Mitbestimmung ausgeschlossen. In den nördlichen Kolonien konnten etwa drei Viertel, in den südlichen bis zu 50 Prozent der weißen Männer an den Wahlen zu den Repräsentativversammlungen (assemblies) teilnehmen. In England waren dagegen in der Mitte des 18. Jahrhunderts nur 15 Prozent der männlichen Bevölkerung wahlberechtigt. In keinem Land der Welt gab es zu dieser Zeit mehr soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmungsrechte als in den englischen Kolonien. Vom Vorbild zum Feindbild Die Kolonien mit ihren um 1770 etwa 2,5 Millionen Einwohnern durften bestimmte Waren wie Zucker und Tabak nur nach England ausführen, außerdem Produkte aus Europa nur über britische Firmen einführen. Diese Beschränkungen durch das Mutterland wurden zunehmend als Ärgernis empfunden und vielfach durch einen fl orierenden Schmuggel umgangen. Der Siebenjährige Krieg hatte die englischen Staatsschulden zudem so stark anwachsen lassen, dass man in London beschloss, die Bürger der Kolonien an den Kosten des Krieges zu beteiligen. Die Regierung in London erhöhte 1764 die Zölle für Einfuhren aus den nordamerikanischen Kolonien und verlangte 1765 eine geringfügige – in England seit Langem erhobene – Gebühr für Kaufverträge, Schuldscheine, Testamente und Druckerzeugnisse aller Art wie Zeitungen oder Kalender. Da die Kolonisten keine Vertreter ins englische Parlament wählen durften, weigerten sie sich, die Steuern und Zölle zu zahlen, und boykottierten britische Waren: „No taxation without representation!“ Die Regierung in London nahm die Steuererhöhungen zurück. o „Pilgrim Fathers – The First Thanksgiving at Plymouth.“ Gemälde von Jennie Augusta Brownscomb, 1912. Im Herbst 1621, ein Jahr nach ihrer Ankunft in Plymouth, beschlossen die Pilgerväter nach der Ernte gemeinsam mit dem benachbarten Wampanoag-Stamm ein Fest zu feiern. Daraus entwickelte sich der Thanksgiving-Day, eine Art Erntedankfest, das in den USA als staatlicher Feiertag immer am vierten Donnerstag im November begangen wird. Eng mit dem Gründungsmythos verbunden, ist die Tradition fest im US-amerikanischen Selbstverständnis verankert. p Analysieren Sie die Stilelemente des Gemäldes. Erläutern Sie seine Aussage. Siebenjähriger Krieg (auch „French and Indian War“ genannt, 1756 1763): unter anderem in Nordamerika ausgetragener Krieg zwischen England und Frankreich, durch den England die Vorherrschaft in Nordamerika für sich entschied. Im Frieden von Paris (1763) musste Frankreich auf Kanada und die Gebiete östlich des Mississippi verzichten. 175Die Ausbildung des US-amerikanischen Selbstbewusstseins Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V rla gs | |
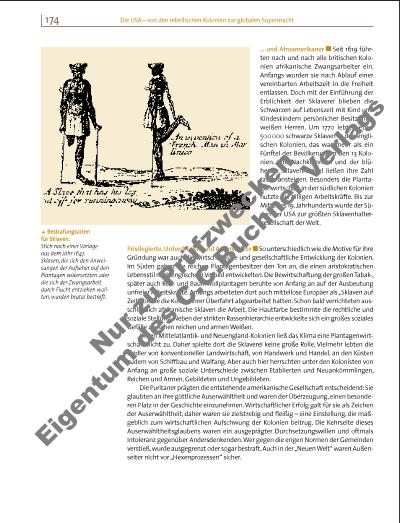 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |