| Volltext anzeigen | |
113 6 Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Anfang des 19. Jh. klagt ein Lehrer über den Umfang der Kinderarbeit und die ungenügende Erfüllung der Schulpflicht. Er fordert Maßnahmen der Regierung. Der zuständige Beamte im preußischen Unterrichtsministerium schreibt darauf 1827: Dass die Kinder überhaupt in Fabriken beschäftigt werden, ist an sich nicht zu miss billigen, und ein allgemeines unbedingtes Verbot dieser Arbeiten würde eine ebenso nachteilige Maßregel für die Fabrikherren als für die Eltern und die Kinder selbst sein, von denen die ers teren dieser wohlfeileren* Arbeiter, die anderen des Arbeitslohnes ihrer Kinder nicht entbehren können, die letzteren aber früh an Tätigkeit und Ausdauer sich gewöhnen lernen. Zwölf Jahre später, im März 1839, erscheint in Preußen die erste amtliche Verordnung; sie legt die Höchstarbeitszeit von zehn Stunden am Tag für Jugendliche unter 16 Jahren fest und untersagt die Annahme von Kindern unter 9 Jahren in Bergwerken, Fabriken, Pechund Hüttenwerken zu einer regelmäßigen Beschäftigung. 1840 legt Bayern in einem Gesetz die tägliche Arbeitszeit für Kinder vom 9. bis zum 12. Lebensjahr auf maximal zehn Stunden am Tag fest und verbietet die Einstellung von Kindern in Fabriken vor dem vollendeten 9. Lebensjahr. Preußen führt 1853 ähnliche Bestimmungen ein. In Sachsen wird die Kinderarbeit erst 1861 eingeschränkt; Württemberg und Baden haben bis 1878 keine gesetzliche Regelung. 1891 verbietet im Reich das Arbeitsschutzgesetz die Beschäftigung von Kindern unter 13 Jahren in Fabriken und legt fest, dass über 13 Jahre alte Kinder nur dann in Fabriken beschäftigt werden dürfen, wenn sie nicht mehr schulpflichtig sind. Den größten Anteil an den außerhalb der Fabriken gewerblich beschäftigten Kindern hat auch noch um 1900 die Hausindustrie. Diese Betriebe fallen nicht unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung. In einer amtlichen Stellungnahme aus dem Jahre 1898 heißt es dazu: Es ergibt sich hieraus, dass die Kinderarbeit in den Fabriken, für welche die Gewerbe ordnung einschränkende Bestimmungen enthält, wesentlich an Bedeutung verloren, im Handwerk, der Hausindustrie und bei sonstiger gewerblicher Beschäftigung aber einen erheblichen Umfang angenommen hat. Eine mäßige Beschäftigung von Kindern mit gewerblicher Arbeit hat insoweit Berechtigung, als sie geeignet ist, die Kinder an körperliche Tätigkeit zu gewöhnen, den Sinn für Fleiß und Sparsamkeit zu wecken, und sie […] vor Müßigang und anderen Abwegen zu bewahren […]. Überall da aber, wo die Arbeit zu lange währt, wo sie zu unpassenden Zeiten und in ungeeigne ten Räumen stattfindet, gibt die Kinderarbeit zu erheblichen Bedenken Veranlassung. Erst 1903 wird das für Fabriken geltende Verbot der Kinderarbeit auf alle Handwerksbetriebe, das Handelsund Verkehrsgewerbe und auf die Schankwirtschaften ausgedehnt. Zusammengestellt nach: Wilfried Feldenkirchen, Kinderarbeit im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 26. Jg. (1981), S. 141 * wohlfeil: hier billig 5 10 15 1. Überlege, welche Arbeiten Kinder vor der Industrialisierung leisten mussten. 2. Erarbeite aus M 6 und M 7, welche Arbeiten Kinder in Fabriken verrichteten. 3. Nenne Gründe für die Kinderarbeit und erkläre, warum sie gesetzlich beschränkt wurde (M 6). 4. Erörtert die Aufforderung, keine Produkte zu kaufen, die durch Kinderarbeit hergestellt wurden. 9 Heimarbeit. Foto, vor 1914. Was wird hier in Heimarbeit produziert? Gibt es heute noch Heimarbeit? 8 Kinder in Fabriken Anteil der Kinder an der Gesamtzahl der Beschäftigten in preußischen Industriezweigen (Angaben in %): 1849 1852 Textilindustrie 11,4 9,1 Eisenwerke 1,2 0,5 Nähnadelund Stecknadelfabriken 72,5 59,8 Glashütten 15,2 14,6 Tabakindustrie 14,2 11,9 Zusammengestellt nach: Wilfried Feldenkirchen, Kinderarbeit im 19. Jahrhundert, a.a.O, S. 21 7 In einer Baumwollspinnerei. Stich von 1839. 4753_099_114 03.11.16 07:43 Seite 113 Nu r z u Pr üf w ck en Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
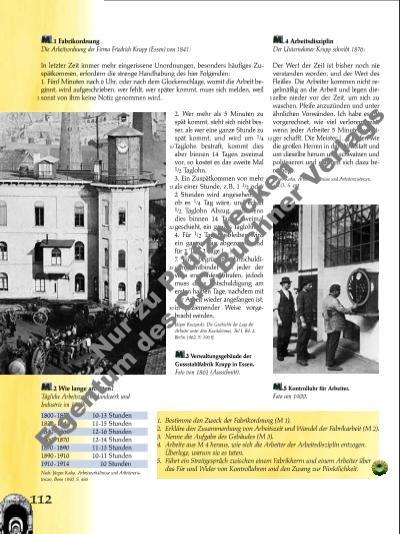 « | 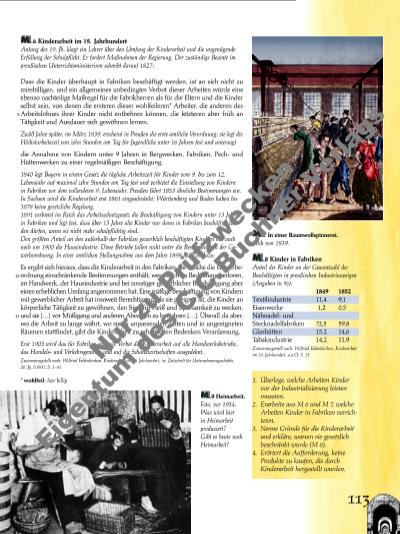 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |