| Volltext anzeigen | |
265Bundesrepublik Deutschland: politische und wirtschaftliche Entwicklung 1949 1989 M6 Chancen und Grenzen der Konsumgesellschaft Der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser referiert Merkmale der bundesdeutschen Konsumgesellschaft: Überraschenderweise konnte die Konsumgesellschaft Bundesrepublik in vielem, was für sie charakteristisch geworden ist, an die Entwicklung der dreißiger Jahre anknüpfen […]. Neu für die Fünfzigerjahre war hingegen, dass der Konsum langlebiger Gebrauchsgüter nicht mehr auf mittlere und gehobene Einkommensklassen begrenzt war, sondern mit wachsendem Realeinkommen in nahezu allen Schichten der Bevölkerung einsickerte. Für den Besitz mancher Konsumgüter wie zum Beispiel für Fernsehgeräte, Musiktruhen oder Kühlschränke spielte in der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre die soziale Stellung kaum noch eine bestimmende Rolle. Die „Demokratisierung des Konsums“ […] setzte sich […] durch. Kennzeichnend für diese Entwicklung ist das Scheitern schichtspezifi sch konzipierter Automobile (z. B. die „Kabinenroller“ von Gutbrod, Maico oder Messerschmidt) […] und der Siegeszug des auf technische Funktionalität und ein (käufer-) schichtübergreifendes Image angelegten Volkswagen-Käfers […]. Das private Automobil wurde in den Fünfzigerjahren zum Schlüsselbegriff für soziales Wohlbefi nden, bürgerliches Freiheitsgefühl, wirtschaftliche Erwerbschancen und gesellschaftliches Prestige. Die Konsequenzen, die sich daraus für Städtebau, Siedlungspolitik, Freizeitgestaltung, Kommunikationsverhalten, Wirtschaftsstruktur, Umwelt, ja nahezu für alle Bereiche des menschlichen Lebens ergaben, revolutionierten das Alltagsleben. […] In dieselbe Richtung zeigten die Herausbildung des Tourismus als Kollektivphänomen und die Expansion des neuen Massenmediums „Fernsehen“. Beide ebenfalls epochemachenden Entwicklungen haben in Deutschland ihren Ursprung in den Dreißigerjahren, sodass auch hier auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen werden konnte. […] Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Hauptstützen der „Konsumgesellschaft“ – Motorisierung, Tourismus und Massenmedien – ihre tiefen Spuren im öffentlichen Bewusstsein und im Lebensgefühl der Massen erst im Laufe der Fünfzigerund Sechzigerjahre hinterlassen haben und daher zu Recht als Ergebnis des „Wirtschaftswunders“ nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden. […] Vor der generellen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage traten andere Probleme der „Wirtschaftswunderzeit“ zurück. […] Je weiter die Motorisierung voranschritt und die Freiheit des Einzelnen zu erweitern versprach, desto mehr stiegen die sozialen Kosten einer „autogerechten“ Welt, in der die Mehrheit der Bundesbürger nunmehr wohnen wollte, und verringerten sich in den Verdichtungsräumen des Straßenverkehrs die Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen Autofahrers. Ursprüngliche Lebensqualität schlug um in Umweltbelastung. Ähnliches gilt für den Massentourismus, dessen Reiz gerade durch die Folgen seiner steigenden Popularität und der Erschwinglichkeit von Pauschalreisen zwangsläufi g Schaden nehmen musste, und für die elektronischen Medien, deren kulturelle Problematik im vollen Maße erst in den Siebzigerjahren erkannt worden ist. Schließlich: In dem Maße, wie die Bundesrepublik in den Fünfzigerjahren zur Industriegesellschaft par excellence geworden ist, hat sie auch deren außerordentliche Probleme in Kauf nehmen müssen. Hohe Abhängigkeit vom Weltmarkt, von Energieimporten und knappen Rohstoffen, starke Umweltbelastungen durch industrielle Emissionen und Abfälle, Zersiedelung der Landschaft durch dezentrale Industrieansiedlung oder Beschäftigungskrisen durch wirtschaftlichen Strukturwandel waren noch keine dringenden Fragen der Sechzigerjahre. Aber all diese Probleme, die die Bundesrepublik jenseits der „Grenzen des Wachstums“ besonders hart trafen, sind in den Langen Fünfzigerjahren entstanden. Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, München 2004, S. 336 341 1. Arbeiten Sie die Kennzeichen der Konsumgesellschaft in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ heraus. 2. Welche Folgen hatte die „Demokratisierung des Konsums“ (Zeile 12)? 3. Beurteilen Sie aus heutiger Sicht das damalige Konsumverhalten. M7 Innere Ordnung und Demokratie In der Schlussdebatte des Bundestages zur Verabschiedung der Notstandsgesetze am 30. Mai 1968 macht sich Außenminister und Vizekanzler Willy Brandt für die Gesetzesvorlage stark: Bisher hatten die Alliierten noch Rechte, die uns als Untermieter im eigenen Haus erscheinen ließen. Das soll jetzt geändert werden. Unsere Bundesrepublik ist erwachsen genug, um die Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten ohne Einschränkung in die eigenen Hände zu nehmen. [...] An dem Tage, an dem eigene deutsche Gesetze zum Schutze unserer Demokratie in Notzeiten in Kraft treten, erlöschen die Rechte, die sich unsere Alliierten bis dahin vorbehalten haben. [...] Wir wissen, meine Damen und Herren, dass manche unserer Mitbürger noch immer fragen, ob denn die Vorsorgegesetze [= Notstandsgesetze] überhaupt nötig seien. Hierzu hat nicht zuletzt der Bundesjustizminister, mein Kollege Dr. Hei 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 5 10 Nu r z u P üf zw ec ke n Ei ge nt um d C .C .B uc h r V er la gs | |
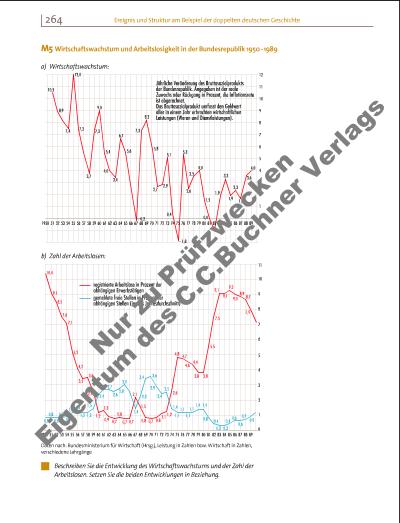 « | 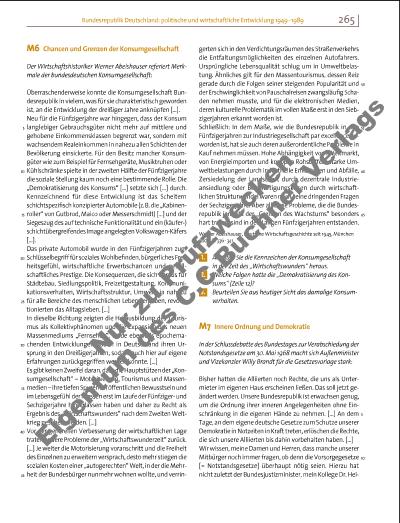 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |