| Volltext anzeigen | |
279Die DDR 1949 1989: Staat und Wirtschaft wurden gezielt gefördert und konnten sich in „Arbeiterund Bauernfakultäten“ auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Bildung sollte kein „bürgerliches“ Privileg mehr sein. Auch die Förderung von Frauen war ein vorrangiges Ziel. Zwischen 1959 und 1965 fand eine umfassende Bildungsreform statt. Im Zentrum stand die zehnklassige „Polytechnische Oberschule“ (POS), die alle Schulpfl ichtigen zu besuchen hatten. Dort lagen die Schwerpunkte auf technischen und mathematischnaturwissenschaftlichen Fächern, auf der Staatsbürgerkunde (Marxismus-Leninismus) sowie auf einer intensiven Sportausbildung. Das Abitur wurde an sogenannten „Erweiterten Oberschulen“ (EOS) abgelegt. Der Staat errichtete zudem ein dichtes Netz an Kinderkrippen, Kindergartenplätzen und Horten zur Vorschulerziehung. Für die berufliche Bildung gab es Ingenieurund Fachschulen, Hochschulen, Akademien und Universitäten sowie Einrichtungen zur Weiterbildung der Beschäftigten. Die Folgen des Bildungsausbaus waren bald zu spüren: Die Zahl der Kinder mit mehr als acht Jahren Schulzeit stieg von 16 Prozent 1951 auf 85 Prozent im Jahr 1970. Um 1970 waren fast die Hälfte der Studierenden an Fachschulen Frauen, an den Hochschulen und Universitäten stieg ihr Anteil jedoch nicht über 30 Prozent. Eine großangelegte „Qualifi zierungsoffensive“ sorgte dafür, dass 1971 71 Prozent der Männer sowie 49 Prozent der Frauen eine abgeschlossene Berufsausbildung besaßen. Frauenarbeit, die in der DDR wegen des Arbeitskräftemangels von Beginn an sehr weit verbreitet war, wandelte sich dadurch von angelernter Beschäftigung zu qualifi zierter Berufstätigkeit. Planung, Zentralisierung und Kontrolle waren die Merkmale der Bildungspolitik in der DDR. Das integrierte Bildungssystem erlaubte dem Staat eine fast permanente Aufsicht über Kinder und Jugendliche, ergänzt durch die Organisation der Heranwachsenden in der Freien Deutschen Jugend. Bei der Förderung von Frauen in Bildung und Berufsleben ging es dem Staat weniger um Emanzipation als vielmehr um die Bereitstellung von Arbeitskräften. Die Bildungsinhalte folgten streng den Anforderungen der Wirtschaft, die ihrerseits der staatlichen Planung unterlag. Jugendliche erhielten selten den Studienplatz oder die Lehrstelle ihrer Wahl, sondern wurden nach Bedarf ausgebildet. Bildung war zwar kein Privileg bestimmter Schichten mehr, dafür hing sie nun vom Willen der Staatsführung ab. Vielen Angehörigen des Bildungsbürgertums verweigerte die Regierung das Studium, um stattdessen eine neue „sozialistische Intelligenz“ zu fördern. Sie bestand aus Fachkräften und Akademikern, die das Regime zu verlässig unterstützten. Dazu gehörten insbesondere die „Kader“, hochqualifi zierte Gruppen in den Betrieben, in Verwaltung, Justiz, Militär und Partei, die unabhängig von ihrer so zialen Herkunft eine neue, staatstragende Elite bildeten. Das SED-Regime nutzte das von ihm geschaffene Bildungssystem auch zur gezielten Einschwörung auf die eigene Weltanschauung: Schüler, Auszubildende und Studierende sollten zuverlässig mit den Lehren des Marxismus-Leninismus vertraut gemacht werden. Im Studium waren „Gesellschaftswissenschaften“ Pfl ichtfach, im ersten Studienjahr auch das Erlernen der russischen Sprache. Zudem trug das Bildungswesen in der DDR stark militaristische Züge. In allen Ländern der Warschauer Vertragsorganisation gab es wehrpolitischen Unterricht an den Schulen. 1978 führte die DDR das Fach „Wehrunterricht“ für Jungen und Mädchen der 9. und 10. Jahrgangsstufe an Oberschulen ein. Es sah neben theoretischer Wehrkunde die Ausbildung an Waffen und technischen Geräten vor, ebenso Aufenthalte in Ferien lagern. Als Ausbilder fungierten Angehörige der Nationalen Volksarmee oder der „Gesellschaft für Sport und Technik“, einer vormilitärischen Jugendorganisation. Der Wehr unterricht war als Vorstufe zum späteren Wehrdienst gedacht und half dabei, Freiwillige für die NVA, die Grenztruppen oder die Volkspolizei zu gewinnen. i Fischwerkerin Anni Paaz. Bronzestatue von 1971 (Höhe: 98 cm). Anni Paaz gehörte zu den Erfolgreichsten im VEB Fischkombinat. Solche Denkmale im Stil des Realismus sollten den Einsatz von Frauen im Arbeitsleben motivieren und das angestrebte Ideal werktätiger Frauen vermitteln. N r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 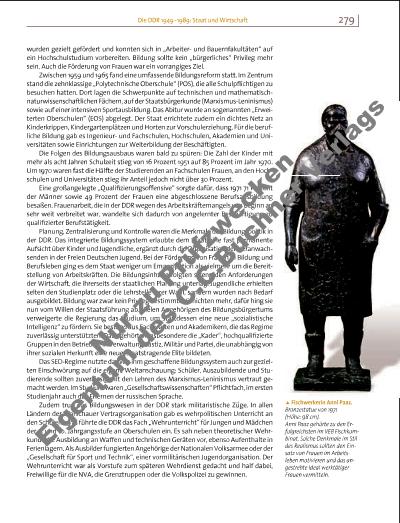 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |