| Volltext anzeigen | |
121Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 3 Abweichendes Verhalten. Foto von 1936 (Ausschnitt). Auf diesem Foto sind Arbeiter und Angestellte der Werft Blohm & Voss aus Hamburg versammelt, die am Stapellauf eines Schiffes teilnehmen. Fast alle haben den Arm zum „Deutschen Gruß“ erhoben. Nur ein Mann hat seine Arme demonstrativ verschränkt. Das Foto gilt heute als Sinnbild für Zivilcourage. ó Erkläre! Der Preis für Ruhe und Ordnung Offene Proteste gegen die Judenhetze und die Verfolgung Andersdenkender waren selten.* Manche Bürger billigten, dass dem „roten Gesindel“, wie sie Kommunisten und Sozialdemokraten herabwürdigend nannten, und den Juden „endlich auf die Finger geklopft“ wurde. Sinti und Roma sowie Homo sexuelle besaßen ohnehin keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Die meisten Deutschen schwiegen aus Gleichgültigkeit oder Angst um sich und ihre Familien. Kritisiert wurden höchstens brutale Übergriffe der SS – allerdings nur hinter vorgehaltener Hand und häufi g mit der Bemerkung: „Wenn das der Führer wüsste ...“ Das NS-Regime bot dem, der sich ihm unterwarf, Arbeit und wirtschaftlichen Aufschwung sowie das Gefühl, „Volksgenosse“ einer aufstrebenden Nation zu sein. Ruhe und Ordnung und der versprochene Wohlstand rechtfertigten für viele ein hartes Durchgreifen gegen „Störenfriede“. Dass die Herrschenden grundlegende Rechte missbrauchten und dass man auch durch Wegschauen und Schweigen Schuld auf sich lud, sahen die meisten Deutschen nicht. Christen im Zwiespalt Obwohl nationalsozialistische Weltanschauung und christliche Gebote unvereinbar waren, passten sich viele Protestanten und Katholiken dem NS-Staat an. Hitler vermied zunächst den Konfl ikt mit den Kirchen. Deren Spitzen kamen ihm anfangs entgegen: In der evangelischen Kirche entstand eine nationalsozialistische Glaubensbewegung: die Deutschen Christen. Der Vatikan verhalf der NS-Regierung im Juli 1933 durch einen Staatsvertrag (Konkordat) zu Ansehen im Inund Ausland. Der Papst verzichtete auf eine politische Betätigung der Geistlichen. Damit glaubte die Kirchenführung, die Freiheit der Religion, die Bekenntnisschulen und die katholischen Verbände erhalten zu können. Auch die Gläubigen verhielten sich zwiespältig. Einerseits widersetzten sich mutige Christen dem Machtanspruch. Andererseits fühlten sich viele von ihren Kirchen im Stich gelassen, da diese zu keiner offenen Absage an den Nationalsozialismus bereit waren, sondern ihn als „Obrigkeit“ anerkannten. „Stumme Zeugen böser Taten“ Im März 1937 wandte sich der Papst mit dem Rundschreiben Mit brennender Sorge an die Katholiken. Er kritisierte die Verdrängung des Christentums aus dem öffentlichen Leben und die „Vergötzung der Rasse“. Ein Protest gegen die Entrechtung der Juden fehlte. Auch später kritisierte die Kirchenführung die Verfolgung nicht. Aber es gab Einzelne wie die Jesuitenpater Rupert Mayer und Alfred Delp, die sich offen gegen das Unrecht wandten. In der evangelischen Kirche löste die Einführung des „Arierparagrafen“ für Geistliche und Kirchenbeamte 1933 Proteste aus. Pastor Martin Niemöller rief zur Gründung des Pfarrernotbundes auf, aus dem sich die Bekennende Kirche entwickelte. Sie wandte sich gegen die staatliche Vereinnahmung der Kirche und gegen die Ausgrenzung von Protestanten jüdischer Herkunft. 1935 forderte sie die Aufl ösung der Gestapo und der Konzentrationslager. Oft blieben die evangelischen Christen aber, wie der im KZ Flossenbürg ermordete Theologe Dietrich Bonhoeffer 1943 schrieb, „stumme Zeugen böser Taten“. *Zum Widerstand lies auch Seite 152 ff. 31013_1_1_2015_100_163_kap3.indd 121 26.03.15 15:30 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
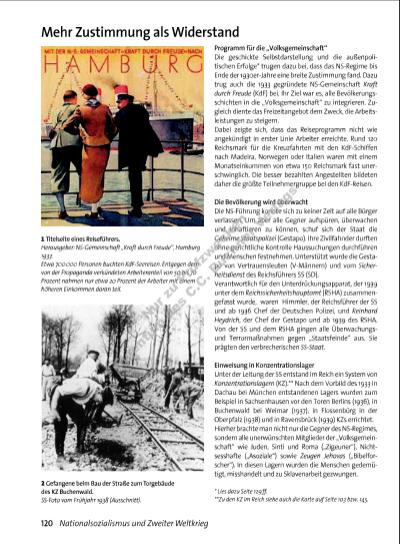 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |