| Volltext anzeigen | |
170 „Volk“ und „Nation“ im Deutschen Kaiserreich Antisemitismus Die Reichsverfassung von 1871 hatte den Juden die völlige persönliche und rechtliche Gleichstellung zugestanden. Trotz dieses obrigkeitsstaatlichen Aktes wurden die Juden im öffentlichen Leben zunehmend dis kriminiert. Der Begriff Antisemitismus wurde erstmals 1879 während des „Berliner Antisemitismusstreites“ geprägt.* Anders als die herkömmliche, vorwiegend religiös oder wirtschaftlich motivierte Judenfeindschaft präsentierte sich der moderne politische Antisemitismus als „Missgeburt des nationalen Gefühls“ (Theodor Mommsen, 1880). Das Judentum wurde als internationale und „undeutsche“ Macht angesehen. Da Juden zu einem großen Teil im Handel tätig waren, wurden sie zu Symbolfi guren der modernen Industriegesellschaft erklärt und für deren negative Begleiterscheinungen verantwortlich gemacht. Dabei waren Juden mittlerweile sehr gut an die Mehrheitsgesellschaft angepasst und legten keinen Wert auf die Betonung einer religiösen Sonderrolle. Die deutschjüdische Bevölkerung zeigte einen hohen Bildungswillen. Entsprechend hoch war ihr Anteil bei Berufen des Bildungsbürgertums wie Ärzten, Anwälten, aber auch Künstlern. Allerdings blieb deutschen Juden die hoch angesehene Offi ziersund Richterlaufbahn verwehrt. Auch bei vielen Vereinen und Burschenschaften war die Mitgliedschaft für Juden nicht möglich. Der Austausch zwischen Juden und der deutschen Mehrheitsgesellschaft, der den Abbau von Vorurteilen gegen Juden hätte befördern können, wurde so erschwert. Die judenfeindlichen Angriffe und die Fülle antisemitischer Literatur blieben nicht folgenlos. 1893 zogen bereits 16 antisemitische Abgeordnete in den Reichstag ein. Auch in die Parteiprogramme der Konservativen gelangten antijüdische Ressentiments. Der parteipolitisch organisierte Antisemitismus fand bevorzugt in Phasen wirtschaftlicher Krisen Zulauf, vor allem bei städtischen Mittelschichten und der Landbevölkerung. Aber auch im Offi zierskorps und unter der akademischen Jugend wurde die Ablehnung der Juden salonfähig. Ausgrenzung von Minderheiten Die Behandlung der ethnischen Minderheiten folgte einer konsequenten Assimilierungspolitik. Von einer strikten „Germanisierungspolitik“ waren die Minderheiten an den Reichsgrenzen betroffen: Polen, Dänen und Litauer. Vertreter dieser Bevölkerungsgruppen im Reichstag wurden als „Reichsfeinde“ bezeichnet. In Schulen und in der Verwaltung musste ausschließlich deutsch gesprochen werden. Ausweisungen und Benachteiligungen beim Landerwerb waren weitere Maßnahmen. Die Politik der Zurückdrängung löste einen Dauerkonfl ikt zwischen der Regierung und der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sowie den ethnischen Minderheiten aus (u M1). Am besten organisierte sich die große und vergleichsweise geschlossene Gruppe der polnischen Bevölkerung gegenüber dieser Politik. Eigene Vereine und eine eigene Bank sollten den Landerwerb unterstützen. Im Reichsprotektorat Elsass-Lothringen wurde immerhin Französisch als Sprache in der Verwaltung und bei Gericht geduldet. Eine eigene Verfassung und ein Parlament gab es aber erst 1911. Zuvor konnte ein Landes ausschuss mit Honoratioren lediglich den Statthalter der Reichsregierung beraten und Gesetze vorschlagen. Konfessionen Anzahl Protestanten 35 231 104 Katholiken 20 327 913 Juden 586 833 Andere 221 328 Muttersprache Gesamt in Prozent Deutsch 51 883 131 92 Holländisch 80 361 0,14 Dänisch 141 061 0,25 Französisch 211 679 0,38 Italienisch 65 591 0,12 Polnisch 3 086 489 5,48 Masurisch1 142 049 0,26 Kassubisch2 100 213 0,18 Sorbisch3 93 032 0,17 Mährisch4 64 382 0,11 Litauisch 106 305 0,19 Andere 139 597 0,25 i Konfessionen im Deutschen Reich. Stand: 1. Dezember 1900. Kaiserliches Statistisches Amt, (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Berlin 1906, S. 4 i Bevölkerung nach Muttersprachen. Stand: 1. Dezember 1900. Differenzen zu 100 Prozent sind rundungs bedingt. Kaiserlich Statistisches Amt, a. a. O., S. 5 1 Masuren: slawische Volksgruppe im süd lichen Ostpreußen 2 Kassuben: slawische Volksgruppe in Pommern und Westpreußen 3 Sorben: slawische Volksgruppe an der Elbe, Niederlausitz (Sachsen) 4 Mähren: aus dem heutigen Tschechien stammende Sprachgruppe * Zum „Berliner Antisemitismusstreit“ siehe M1 bis M3 auf S. 178 f. 4677_1_1_2015_158-183_Kap5.indd 170 17.07.15 12:26 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
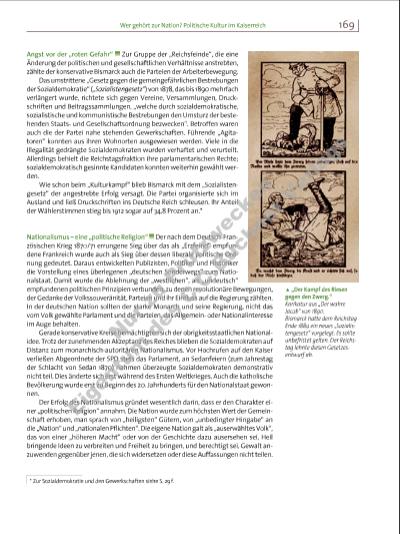 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |