| Volltext anzeigen | |
296 Methoden-Baustein Antifaschismus und Antitotalitarismus Der Historiker und Politikwissenschaftler Martin Sabrow (geb. 1954) vergleicht, wie nach 1945/49 in der Bundesrepublik und in der DDR „Vergangenheitspolitik“ betrieben worden ist: Der Kampf um und gegen die nationalsozialistische Vergangenheit zählt zu den großen Gemeinsamkeiten der im doppelten Sinne geteilten deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte. Dennoch stößt eine deutende Zusammenschau des ost-westlichen Umgangs mit der NS-Zeit zwischen 1945 und 1989/90 auf erhebliche Schwierigkeiten: Zu unterschiedlich erscheinen die beiderseitigen Anstrengungen, die nahe Vergangenheit des nationalsozialistischen Zivilisationsbruchs für die Gegenwart handhabbar zu machen [...]. […] Nach 1945 waren beide deutsche Nachfolgestaaten des „Dritten Reiches“ vor die Aufgabe gestellt, eine Vergangenheit zu bewältigen, die der deutschen Gesellschaft nicht von außen oktroyiert1 worden, sondern aus ihrer Mitte erwachsen war. Der ostdeutsche Staat reagierte mit einer bis zum Untergang des SED-Staates offi ziösen Kultur der Heroisierung, die über dem aktiven Kampf gegen das NS-Regime das passive Leiden an ihm ebenso überging wie den Massenkonsens mit ihm. [...] Schon 1948 war das Schicksal von Verfolgten außerhalb des kommunistischen Widerstandes und besonders Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik im Rundfunk der Sowjetischen Besatzungszone kein Thema mehr. […] Grundsätzlich anders reagierten Staat und Gesellschaft in der Bundesrepublik. Hier herrschte über viele Jahre eine Verdrängungshaltung vor, die sich als „Selbstviktimisierung“2 bezeichnen lässt und die die eigene Täterschaft hinter der Selbstwahrnehmung als Opfer brauner Verführung, angloamerikanischer Bombardierung und sowjetischer Siegerwillkür zurücktreten ließ. In den Westzonen und der frühen Bundesrepublik wurde die Abwehr der von den westlichen Besatzungsmächten in Gang gesetzten und schnell als oktroyiert empfundenen Reinigung zum Ausgangspunkt einer Vergangenheitsbewältigung, die die Monstrosität des nationalsozialistischen Regimes und seiner Verbrechen weitgehend verdrängte. [...] Der Kontrast zwischen den beiden Geschichtskulturen in der Zeit der deutschen Teilung ist also denkbar grell. In Ost und West schied sich die Erinnerung an die „zwölf Jahre des Tausendjährigen Reiches“ nach den Grenzlinien des Kalten Krieges und diente der wechselseitigen Systemintegration mithilfe der spiegelbildlichen geschichtspolitischen Interpretationsmuster, die einmal den kommunistischen Widerstand und zum anderen den nationalkonservativen und christlichen Widerstand akzentuierten, einmal die verhängnisvolle Macht des Monopolkapitals beschworen und zum anderen die Verführungskraft von Umsturzideologien. Doch selbst diese Polarität macht einen integrativen Blick auf die doppelte deutsche Vergangenheitsverarbeitung keineswegs sinnlos. […] Befördert durch die politischen Entwicklungen der Zeit […] entwickelten beide Gesellschaften ein kohärentes3 Konsensmodell der Vergangenheitsaneignung, das die Erinnerung an die NSGeschichte in politischer Absicht nutzte und das in beiden Fällen als Integrationskonzept sehr erfolgreich war. Im Osten trat es als Antifaschismus, im Westen als Antitotalitarismus in Erscheinung und besaß auf beiden Seiten einerseits hohe politische Instrumentalität, trug andererseits starke tabuisierende Züge und konnte deswegen trotz seiner inhaltlichen Gegensätzlichkeit eine in West und Ost gleichermaßen ausgeprägte Entlastungsfunktion wahrnehmen. Der „Legitimationsantifaschismus“ in der DDR trug politisch instrumentelle Züge, die ihn zu einem wirkungsmächtigen Mittel der kommunistischen Herrschaftsetablierung im Osten Deutschlands machten […] und zu einem schlagkräftigen Argument im propagandistischen Kampf gegen die demokratische Ordnung im Westen Deutschlands. […] Ausgangspunkt: Frage, ob sich die Aufarbeitung der NS-Geschichte in beiden deutschen Staaten integrativ betrachten lässt Problem: Sehr unterschiedliche Verarbeitungsweisen der Verbrechen des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik und in der DDR These zur Aufarbeitung in der DDR: Heroisierung des kommunistischen Widerstandes und Verdrängung der breiten Zustimmung zum NS-System These zur Aufarbeitung in der jungen Bundesrepublik: Verdrängung und Selbstviktimisierung Erste Schlussfolgerung: Unterschiedliche Verarbeitungsund Verdrängungsweisen in der Bundesrepublik und der DDR Argumentation: Integrative Betrachtungsweise der „Vergangenheitsbewältigung“ in Ost und West ist dennoch möglich Kernthese: Die Erinnerung an die NS-Geschichte diente in Ost und West als Integrationskonzept sowie zur Entlastung Thesen: Wie funktionierte die Aufarbeitung in der DDR? 5 10 15 20 25 30 35 40 1 oktroyieren: jemanden etwas aufdrängen oder auferlegen 2 Selbstviktimisierung: Selbstinszenierung als „Opfer“ 3 kohärent: zusammenhängend Beispiel und Analyse 4677_1_1_2015_276-311_Kap8.indd 296 17.07.15 12:09 N r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 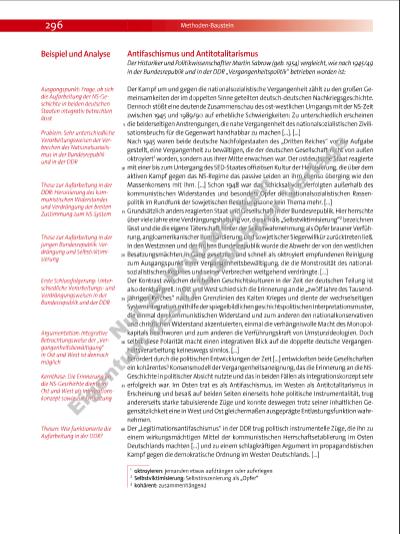 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |