| Volltext anzeigen | |
328 Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutschland Langsame Abkehr von der Nation? Selbstverständnis und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland Eintritt in das westliche Verteidigungsbündnis Die Bundesrepublik Deutschland besaß bei ihrer Gründung 1949 keine Streitkräfte und eine Wiederbewaffnung hing von der Billigung der Westmächte ab. Während des Korea-Krieges (1950 1953) machte die USA ihren Verbleib in Europa als militärische Schutzmacht von der Bereitschaft der Europäer abhängig, ihre eigenen Rüstungsanstrengungen zu verstärken, weshalb auch die Bundesrepublik eine eigene Streitkraft erhalten sollte. Bundeskanzler Adenauer sah in der Wiederbewaffnung die Chance, schneller als erwartet das Besatzungsregime zu beenden und eine militärische Sicherheitsgarantie der USA für die Bundesrepublik zu erwirken. Zwischen März und April 1952 brachte Stalin in mehreren Noten den Vorschlag ein, ein blockfreies und geeintes Deutschland zu gründen. Doch die Stalin-Noten wurden von den Westmächten und von Adenauer abgelehnt, da eine demokratische Verfassung nicht garantiert war und auch über Stalins Motive Unklarheit herrschte. Am 26. Mai 1952 wurde das Ende der Besatzungszeit von den drei ehemaligen Westalliierten im Deutschlandvertrag vertraglich festgehalten. Nach dem Verzicht der Bundesrepublik auf atomare, biologische und chemische Waffen einigte man sich 1954 mit der Unterzeichnung die Pariser Verträge zudem darauf, dass der westdeutsche Staat im Mai 1955 in das Verteidigungsbündnis des Westblocks, die NATO*, aufgenommen wird (u M1). Im gleichen Jahr wurde die Bundewehr gegründet. Außerdem billigte Frankreich den Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik nach einer Volksabstimmung am 1. Januar 1957. Mit dem Ende der Besatzung versicherten die Westmächte schließlich in einem zweiten Deutschlandvertrag, mit friedlichen Mitteln die Wiedervereinigung eines freiheitlich-demokratischen Deutschland, das in die europäische Gemeinschaft integriert ist, verwirklichen zu wollen. Das bundesdeutsche „Wirtschaftswunder“ Die Grundlage aller staatlichen Sozialleistungen war der unerwartet rasche wirtschaftliche Aufstieg. Das reale Bruttosozialprodukt nahm in den Fünfzigerjahren jährlich um acht Prozent zu, zwischen 1950 und 1970 verdreifachte es sich nahezu. Entsprechend wuchs das verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer. Als geistiger Vater und Repräsentant des „Wirtschaftswunders“ galt Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Der Erfolg seines Konzepts der „Sozialen Marktwirtschaft“ war spätestens 1952 unübersehbar. Der Aufschwung führte zu anhaltender Vollbeschäftigung und wachsendem Wohlstand. Die Entwicklung profi tierte von mehreren Faktoren: • Es gab genügend qualifi zierte und motivierte Arbeitskräfte. • Die Kriegsschäden waren geringer als befürchtet. Die Industrie konnte von einer gut ausgebauten Infrastruktur (Maschinen und Fabrikanlagen) ausgehen, die sich rasch modernisieren ließ. • Dabei half auch eine zunächst bewusst zurückhaltende Tarifpolitik** der Gewerkschaften: Sie versetzte die Unternehmen in die Lage, ihre Gewinne für Investitionen zu verwenden (Selbstfi nanzierung). i „NATO – seine Kameraden, unsere Verbündeten.“ Plakat (119 x 83,6 cm), um 1956. Herausgegeben vom Presse und Informationsdienst der Bundesregierung. * Zur NATO siehe S. 490. ** Löhne und Arbeitsbedingungen werden von Arbeitgeberund Arbeitnehmer verbänden vereinbart, ohne dass sich der Staat einmischt (Tarifautonomie). Literaturtipp: Marie-Luise Recker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, München 32009 4677_1_1_2015_312-361_Kap9.indd 328 17.07.15 12:12 Nu r z u Pr üf zw e ke n Ei ge nt um d s C .C . uc hn r V er la gs | |
 « | 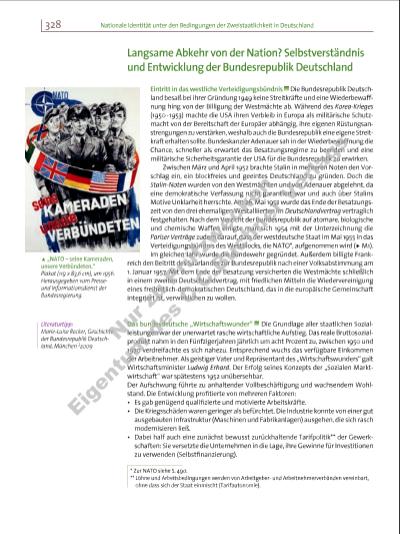 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |