| Volltext anzeigen | |
Literaturtipp: Richard Schröder, Irrtümer über die deutsche Einheit, Freiburg im Breisgau 22014 390 Die Überwindung der deutschen Teilung in der „friedlichen Revolution“ von 1989 Die Geschichtskultur des vereinigten Deutschland Mit dem Beitritt der DDR verschwanden auch deren Geschichtskultur und symbolische Repräsenta tionen. Die Staatsbezeichnung des vereinigten Deutschland, die Flagge und Hymne waren diejenigen der Bundes republik. Die materielle Folie der DDR-Geschichtskultur, d. h. die Namen der Straßen, Plätze und Institutionen, die Denkmäler und symbolträchtigen Gebäude, so beispielsweise der ehemalige „Palast der Republik“, verschwanden, während sich Benennungen, die sich an der Geschichtskultur der alten Bundesländer orientieren, allmählich auch im Beitrittsgebiet verbreiteten. Die Bundesrepublik wandte sich, anders als nach 1945, unverzüglich der Aufarbeitung der Vergangenheit zu. Die Verbrechen der DDR-Diktatur wurden öffentlich gemacht, den Opfern wurde materiell und symbolisch Genugtuung verschafft, die Täter wurden bestraft. Wenn in geschichtskulturell ausgerichteten Reden der Politik die DDR thematisiert wird, kommen fast ausschließlich die Facetten Repression und Mangel in der DDR zur Sprache. Dagegen führten Ohnmachtsgefühle und Anpassungsprobleme vieler Ostdeutscher während der ersten Jahre der Wiedervereinigung vielfach zu einer nostalgischen Verklärung des Sozialismus, der in der Zusammensetzung von „Osten“ und „Nostalgie“ teils humorvoll, teils kritisch „Ostalgie“ genannt wird. Eine Mischung aus sentimentaler Rückbesinnung auf die DDR, Ablehnung westlicher Lebensart, Ausländerfeindlichkeit, Sehnsucht nach Gemeinschaft, Harmonie und Heimat machte es möglich, die DDR im Nachhinein positiv zu bewerten. Erinnerungen an die „Geborgenheit“ im Kollektiv, die ruhige Gangart in den Betrieben, die solidarische Hilfe unter den Nachbarn und Freunden waren gegenwärtig und verwiesen auf einen aktuellen Verlust. Auch wenn solche und ähnliche Erinnerungen häufi g nur teilweise mit der realen Vergangenheit übereinstimmten, bildeten sich doch die Maßstäbe für die Einschätzung der gegenwärtigen Lebenslagen. Dennoch wollten nur wenige Bürger der neuen Bundesländer die DDR zurück haben. Allerdings nahmen die Skepsis gegenüber der Praxis der Demokratie und die Unzufriedenheit mit manchen Folgen der Marktwirtschaft und gesellschaftlichem Pluralismus im vereinigten Deutschland zu (u M3). Der Staatsfeiertag des vereinigten Deutschland Dass der 3. Oktober Nationalfeiertag des vereinigten Deutschland werden solle, war nie Gegenstand einer eigenständigen Bundestagsdebatte und wurde nach vorheriger Absprache von Bundeskanzler Helmut Kohl mit den Ministerpräsidenten während der Aussprache zum Einigungsvertrag am 5. September 1990 als vollendete Tatsache präsentiert. Die Praxis, die zentrale Feier zum „Tag der Deutschen Einheit“ jährlich in einer anderen Landeshauptstadt auszurichten, ging auf einen Vorschlag von Innenminister Wolfgang Schäuble zurück. Formal knüpft die Ausrichtung der Feier an die antirituellen Traditionen der Bundesrepublik an (u M4). „In der Vergangenheit hat deutsches Nationalbewusstsein bei den benachbarten Völkern nicht nur Sympathie geweckt. Solange wir aber den ‚Tag der Deutschen Einheit‘ auch als einen symbolischen Tag der gesellschaftlichen Solidarität, einen Tag der Freiheit und der Völkerfreundschaft verstehen, werden wir ihn noch oft zusammen mit unseren ausländischen Nachbarn feiern können“, äußerte der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine 1993 in seiner Festrede. i Ende der DDR-Geschichtskultur. Foto von 1993. Wenige Jahre nach der politischen „Wende“ von 1989 wird im Osten Berlins ein Haus abgerissen, an dessen Fassade noch für das längst geschlossene Museum für deutsche Geschichte geworben wird. 4677_1_1_2015_362-397_Kap10.indd 390 17.07.15 12:16 Nu r z u P üf zw ec ke n Ei ge nt um es C .C .B uc h er V er la gs | |
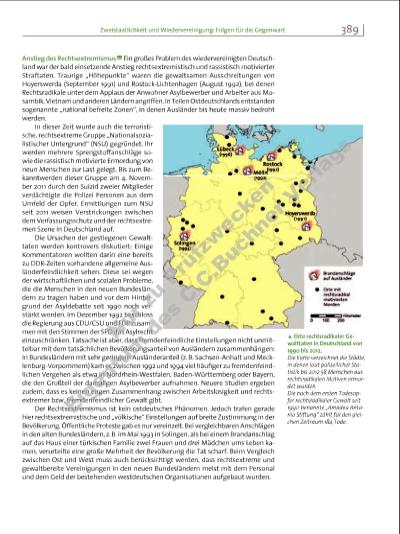 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |