| Volltext anzeigen | |
Überblick: Sie lernen in diesem Kapitel die Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland sowie die Aufgaben und Lösungskonzepte der Wirtschaftspolitik kennen. Methodisch stehen Fallbeispiele und Daten, aber auch Modelle und Theorieansätze der Ökonomie im Mittelpunkt, die im Hinblick auf Chancen und Risiken ausgewertet werden (damit bereiten Sie sich gleichzeitig auf die Anforderungen in vielen Studiengängen vor). Inhaltlich geht es um Instrumente, Gefahren und Konzepte in den zentralen Politikfeldern der Geldpolitik der EZB – und um deren Spannungsfelder zur nationalen Fiskalund Ordnungspolitik in den EU-Staaten. Durch die aktive Auseinandersetzung mit diesem Thema können Sie unter anderen folgende Kompetenzen erwerben: Sachkompetenz: Ich kann … ⦁ Ursachen, Messverfahren, Wirkungen von Inflationen und historische Erfahrungen dazu darstellen. ⦁ die „Indikatorenproblematik“ am Beispiel der Messung der Inflation und des Wachstums verdeutlichen. ⦁ Zinsarten unterscheiden und deren Bedeutung für Sparer und Kreditnehmer erklären. ⦁ Institutionen und Instrumente des Eurosystems in ihrem Zusammenhang unterscheiden. ⦁ die Ursachen von Finanzkrisen und die aktuellen Herausforderungen der Geldpolitik darstellen. ⦁ die Wirkungsweise der neuen Instrumente nach „Basel III“ erklären (Vertiefung). ⦁ Konzepte staatlichen Handelns und übernationaler Geldpolitik unterscheiden und beurteilen. Methodenkompetenz: Ich kann … ⦁ die Möglichkeiten für Eingriffe der EZB in Politik und Wirtschaft anderen darstellen. ⦁ bei geldpolitischen Problemstellungen mit passenden Fachbegriffen und Theorien arbeiten. ⦁ Zusammenhänge zwischen Theorien und Konzepten keynesianischer Fiskalpolitik bzw. neoklassisch orientierter Ordnungspolitik (Kapitel 1) und Entsprechungen in der Geldpolitik (Kapitel 2) herstellen. ⦁ Mechanismen wie Mindestreserve, Geldschöpfung, Eigenkapitalberechnung in ihrer Bedeutung auswerten (Vertiefung). ⦁ alternative wirtschaftspolitische Konzeptbeispiele grundlegenden Konzeptionen der Ökonomie zuordnen. Urteilskompetenz: Ich kann … ⦁ die „institutionenökonomische“ Bedeutung der Unabhängigkeit der Zentralbank von der Politik beurteilen. ⦁ den Stabilitätsund Wachstumspakt sowie „Fiskalpakt“ der EU im Hinblick auf die Zielkonkurrenz von Schuldenabbau und Wachstum einschätzen. ⦁ die unterschiedliche ökonomische Situation verschiedener EU-Länder analysieren und Handlungsoptionen beurteilen. ⦁ Strategien der EZB in Form der Staatsanleihenkäufe, Rettungsschirme und Varianten der Euro-Bonds unterscheiden. ⦁ gesetzliche Grundlagen darstellen und Konsequenzen beurteilen. ⦁ die besondere ökonomische Bedeutung Deutschlands in der EU einschätzen. Handlungskompetenz: Ich kann … ⦁ die Zielkonflikte und Zusammenhänge zwischen Inflation, Beschäftigung und Schuldenabbau analysieren. ⦁ bei der Analyse von wirtschaftspolitischen Konflikten angemessene Lösungsstrategien entwickeln. ⦁ mich in Diskursen zur Wirtschaftspolitik beteiligen. Personale und soziale Kompetenzen: Ich kann … ⦁ den ökonomischen Wandel der EU aus der Sicht meiner zukünftigen Rolle als Arbeitende/r hinterfragen. ⦁ mich zu Alternativen bei wirtschaftswissenschaftlichen Problemstellungen begründet positionieren (insbesondere bezüglich Problemstellungen wie Sparen und Wachstum, Inflation, Euro-Bonds). ⦁ Perspektiven Deutschlands und anderer EU-Länder klar unterscheiden und mich in diese hineinversetzen. Nu r u Pr üf zw ec ke Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V rla gs | |
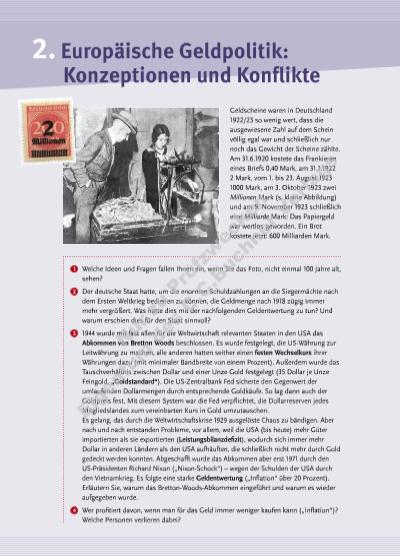 « | 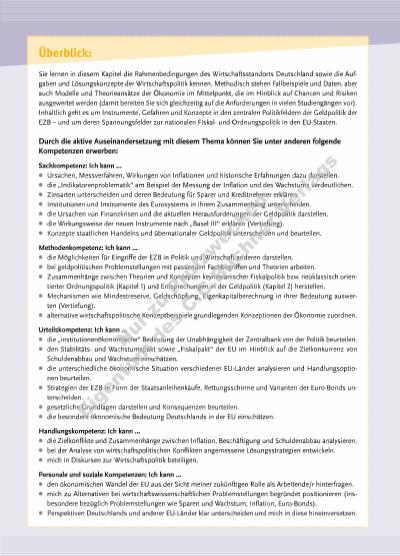 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |