| Volltext anzeigen | |
Eigentum als Grundlage der sozialen Ordnung ... Die Bedeutung des Eigentums und seiner Regelungen reicht weit über die Sphäre der reinen Rechtsordnung hinaus. Hier zeigt sich besonders ein dringlich, wie enge Fäden das Recht mit den anderen großen Lebensord nungen verbinden, und dass das Recht niemals isoliert betrachtet werden darf, sondern als eines der Mittel, deren sich eine Gemeinschaft bedient, um wirtschaftliche, soziale und sittliche Ideale zu verwirklichen und zu sichern. (...) Das Privateigentum ist auch die Grundlage für die soziale Ordnung. Denn auch diese gestaltet sich völlig verschieden je nach der Ausdehnung und Anerkennung des Eigentums. Der soziale Aufbau einer Gesellschaft wird wesentlich dadurch mitbestimmt, ob Boden, Häuser, Unternehmen und Kapitalien Objekt privaten Eigentums sind oder nicht, ferner dadurch, ob sie nach der Rechtsordnung jedem Rechtsgenossen zugänglich sind oder nur bestimmten Klassen (wie lange Zeit Teile des ländlichen Bodens nur dem Adel). Die soziale Ordnung ist freilich nicht allein von der Rechtsordnung ab hängig, wird aber weitgehend durch sie bestimmt. (...) Wird das Privateigen tum richtig als Inbegriff von Rechten und Pflichten aufgefasst, kann es auch die ethischen Kräfte im Individuum stärken. (...) Vor allem darf man nicht übersehen, dass das Privateigentum im Durchschnitt immer noch die sicherste Grundlage für die Unabhängigkeit des Einzelnen ist, ohne welche gerade ein demokratisches Gemeinwesen nicht bestehen kann. (...) Damit wird das Ei gentum zu einem Mittel, die Persönlichkeit auszubilden. Schließlich ist nicht zu übersehen, dass Privateigentum in der Regel durch Arbeit geschaffen und erhalten wird, also eine ethische Grundlage hat.“ Prütting 2008, S. 113 ff. ... und der Wirtschaftsordnung „Aus Art. 14 GG ergibt sich, dass das Grundgesetz eine Wirtschaftsordnung vorsieht, die auf dem Eigentum und den mit ihm begrifflich verbundenen Verfügungsrechten aufbaut. Eigentumsgarantie und Art. 19 II GG begrenzen die Möglichkeiten staatlicher Wirtschafts und Gesellschaftspolitik. Das hat Konsequenzen: Allen eigentumsfeindlichen Wirtschaftssystemen ist eine Absage erteilt. Art. 14 GG lässt sich nicht reduzieren auf eine Garantie, die lediglich private Bedarfsgegenstände schützt (...). Eigenverantwortlichkeit der Unternehmer, freie Disposition über Betriebsmittel, Wettbewerbsfreiheit, Konsum und Werbefreiheit dürfen in ihrem Wesensgehalt nicht angetastet werden. Die auf der Anerkennung von Privateigentum beruhende Markt wirtschaft war auch die Grundlage der Eingliederung der westdeutschen Wirtschaft in die Weltwirtschaft. Je weiter dieser Prozess der Einbindung vorangetrieben wurde, umso mehr hat sich dieses Wirtschaftssystem verfes tigt. Diese ‚Zementierung‘ der marktwirtschaftlichen Konzeption verwundert nicht. Sie hängt eng mit der Eigentumsgarantie zusammen, der schließ lich auch der Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken ist. Ein Staat, der Eigentum nicht garantiert, wird auch nicht mit ausländischen Investitionen rechnen können. Diese waren es aber unter anderem, die ent scheidend zum Wiederaufschwung beigetragen haben.“ Arndt/Rudolf 2007, S. 119 f. Art. 14 Grundgesetz (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestim men. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streit falle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 1938.1 Inhalt, Bedeutung und Schutz des Eigentums Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C. C. B u hn r V er la gs | |
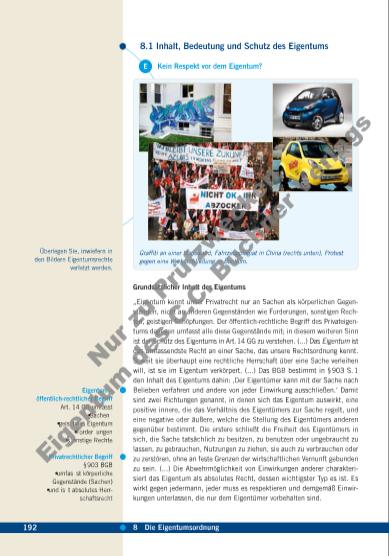 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |