| Volltext anzeigen | |
130 6 Europäische Flüchtlingspolitik – das Ende von Humanität und Solidarität? O R IE N TI E R U N G S W IS S E N Die in die EU Flüchtenden nehmen große Gefahren auf sich: Seit 1988 starben beim Untergang der oft überfüllten Boote mindestens 20.000 Menschen. Auch die Binnenwanderung durch den afrikanischen Kontinent ist häufig lebensbedrohend (Krankheiten, Hunger, Misshandlungen u.Ä.). Die meisten Grenzübertritte finden an der griechisch-türkischen (See-)Grenze statt. Dort wandern in der Hauptsache aber Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak ein. Motive der zumeist jungen Migranten lassen sich – neben der Flucht vor Bürgerkrieg und der politischen Verfolgung – unter dem Begriff der Perspektivlosigkeit bündeln: Sozial fehlt es in den Herkunftsländern oft an Bildungsund Gesundheitschancen, politisch an Partizipationsmöglichkeiten (autoritäre Regime wie z. B. in Eritrea), ökonomisch an Arbeitsmarktchancen, ökologisch an intakter Umwelt (mit Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung). Zudem existieren lose oder engere MigrantenNetzwerke, die ein positives Bild vom Zielland (re-)produzieren. Die Mitgliedstaaten der EU reagieren höchst unsolidarisch auf die starke zahlenmäßige Ausweitung der Flucht. Wirtschaftsstarke EU-Staaten ohne Grenzen zu Afrika oder Asien (wie Deutschland) sperrten sich jahrelang gegen eine Verteilungsquote. Sie überließen damit Ländern wie Griechenland, Italien oder auch Ungarn die Problemlösung. Möglich wurde diese Politik durch das sogenannte Dubliner Übereinkommen, wonach das gesamte Asylverfahren in dem EU-Staat durchgeführt werden soll, den der Geflüchtete als erstes betritt. Als die Aufnahmestaaten – teils wegen finanzieller und administrativer Überforderung – die Registrierung der Geflüchteten faktisch einstellten und die Wanderungsrouten nach Mittel-Nordeuropa öffneten, entsolidarisierten sich weitere Länder: Sie ermöglichten entweder ebenfalls die Passage oder schlossen – entgegen dem Schengener Abkommen – gar Grenzen und versahen diese mit Zäunen. Neben den politischen Kosten der Entsolidarisierung entstehen auch ökonomische Kosten in Milliardenhöhe durch die Einschränkungen des freien Warenund Personenverkehrs. Die Europäische Union hat sich im Wesentlichen auf eine Verstärkung der Abschottung der Außengrenzen verständigt: Aus elf zentralen Aufnahmelagern („Hot Spots“) sollen angeblich nicht Asylberechtigte schnell wieder abgeschoben werden, der Grenzschutz wird massiv verstärkt und der Zuständigkeit der Grenzstaaten teilweise sogar enthoben. Der Türkei und anderen Staaten mit einer großen Zahl an Bürgerkriegsflüchtlingen im Land werden Milliardenhilfen gewährt – offensichtlich, um eine weitere Flucht in die EU einzudämmen. Migrationsgestaltung wie z. B. Asyloder gar Visaanträge aus Flüchtlingslagern heraus oder gezielte Arbeitskräfteanwerbung findet sich so gut wie gar nicht in der Migrationspolitik der EU. Migration in die EU – Ursachen Kap. 6.2 M 2, M 3 Reaktion der EU-Staaten auf Ausweitung der Migration Kap. 6.1 M 2; Kap. 6.3 M 1-M 3 Reaktion der EU auf Ausweitung der Migration Kap. 6.4 M 2, M 3 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
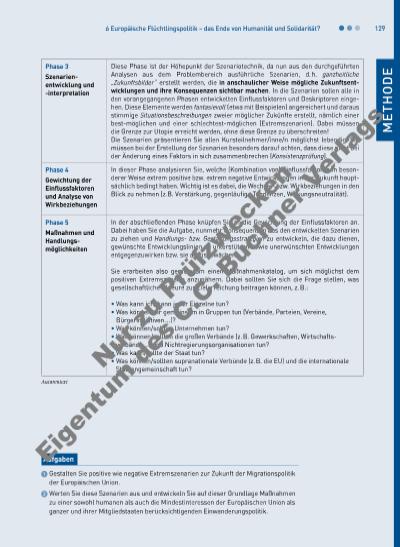 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |