| Volltext anzeigen | |
186 8 Quo vadis, Europa? Herausforderungen und Perspektiven des europäischen Projekts O R IE N TI E R U N G S W IS S E N Die geografische Erweiterung der EU und die inhaltliche Vertiefung der Zusammen-arbeit stehen in einem Spannungsverhältnis, weil zunehmende wirtschaftliche und politische Heterogenität weitere Integration erschwert, die Entwicklung ist offen. Die „Kopenhagener Kriterien“ wurden 1993 in Vorbereitung der Osterweiterung formuliert. Sie stellen klare Anforderungen an Beitrittskandidaten und sollen eine Gefährdung der EU durch den Beitritt labiler Staaten verhindern: • politisches Kriterium (Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte) • wirtschaftliches Kriterium (Marktwirtschaft, Konkurrenzfähigkeit) • acquis-Kriterium (Übernahme des gesamten EU-Rechts) Für Verhandlungen mit der Türkei wurden das Beitrittsverfahren modifiziert und weitere Bedingungen formuliert. Nach vielen Jahren des Austausches wurden 2005 Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen. Seitdem wurden in Bezug auf das politische Kriterium zunächst Fortschritte erzielt (u.a. weitestgehend freie und faire Wahlen und zahlreiche Rechtsreformen), in jüngerer Zeit kritisiert die EU aber Rückschritte bei der Durchsetzung von demokratischen Grundrechten, der Meinungsund Versammlungsfreiheit und beim Kampf gegen die Korruption. Die Diskussion um einen Beitritt der Türkei betrifft auch das Selbstverständnis der EU. Die Funktionsfähigkeit der bisherigen Institutionen und Regelungen scheint bei einer weiteren Ausdehnung von der steigenden Zahl der Akteure und der zunehmenden Heterogenität der Lebensverhältnisse gefährdet. Als mögliche konstituierende Bestandteile einer europäischen Identität wird u. a. auf das Christentum und prägende Etappen der Kulturgeschichte (römisches Recht, Reformation, Aufklärung) verwiesen. Im Beitritt eines überwiegend islamischen Landes, das diese Traditionen nicht teile, sehen Kritiker eine Gefährdung der „Europäischen Identität“. Wie weit die Integration in der EU reichen soll, wird weiterhin kontrovers diskutiert. Zur Debatte steht weiterhin das Ziel einer Föderation (mit stärkerer Souveränität der EU-Organe), aber auch das Beibehalten des aktuellen Integrationsstands oder eine Reduzierung der EU-Zuständigkeit zugunsten der Nationalstaaten sind denkbar. In wichtigen Politikfeldern werden die Ergebnisse der bisherigen EU-Integration in Frage gestellt: Angesichts der „Euro-Krise“ werden die vereinbarten Mechanismen der EWWU hinterfragt; der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa hat zu Auseinandersetzungen über das vereinbarte „Dublin-Verfahren“ zur Aufnahme von Flüchtlingen und zur zeitweiligen Aussetzungen der Schengen-Regeln an Binnengrenzen geführt. Der Erfolg nationalistischer und EU-kritischer Parteien in mehreren Mitgliedstaaten lässt einen Ausstieg von Staaten aus einzelnen Gemeinschaftsprojekten oder der gesamten EU möglich erscheinen. Nachdem die britische Bevölkerung 2016 in einem Referendum für den Austritt aus der EU votiert hat, ist offen, mit welchem Ziel und welchen Mitteln die EU künftig gestaltet werden soll. Erweiterung und Vertiefung Kriterien für einen EU-Beitritt Kap. 8.1 M 2 Diskussion um die Türkei Kap. 8.1 M 5, M 7 Identitäts diskussion Zielvorstellungen und Szenarien Kap. 8.2 M 1, M 2 Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C . B uc hn r V er la gs | |
 « | 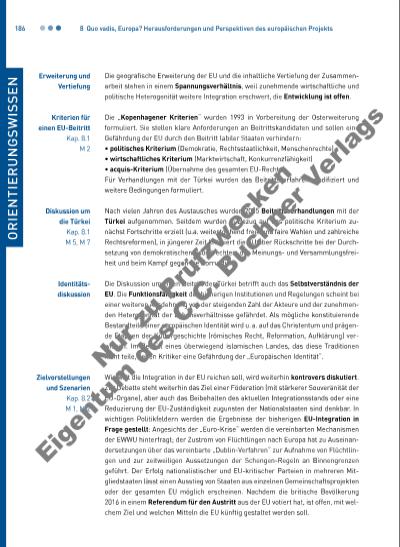 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |