| Volltext anzeigen | |
66 3 Gesetzgebung in der EU – am Beispiel der CO2-Neuwagenverordnung O R IE N TI E R U N G S W IS S E N Die Gipfeltreffen der Staatsund Regierungschefs, die zusammen mit dem Kommis-sionspräsidenten den Europäischen Rat bilden, legen die Leitlinien der EU-Politik fest, ohne jedoch gesetzgeberische Kompetenzen zu besitzen. Gleichwohl fallen in diesem Kreis – gerade im Kontext der Euro-Krise – immer wieder wichtige Entscheidungen, die dann über den Ministerrat in den Entscheidungsprozess eingespeist werden. Sowohl für den Europäischen Rat wie auch den Ministerrat stellt sich die Frage der Legitimation seiner Politik, da seine Mitglieder nur indirekt legitimiert sind. Zugleich wird das nationalstaatliche Gewaltenteilungsprinzip unterlaufen, sind es doch Mitglieder (nationaler) Exekutiven, die auf europäischer Ebene legislative Aufgaben mit Auswirkungen für die Politik in ihrem Heimatland übernehmen. Der Gerichtshof der Europäischen Union (als Zusammenschluss von EuGH, Gericht und Gericht für den öffentlichen Dienst) hat als höchstes Gericht der EU insbesondere die Aufgabe, auf Antrag zu prüfen, ob die Rechtsakte der EU rechtmäßig sind (Nichtigkeitsklagen) und die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen aus den Verträgen nachkommen (Vertragsverletzungsverfahren). Dem Gericht mit Sitz in Luxemburg gehört je ein Richter pro Mitgliedstaat an, die für sechs Jahre (mit der Möglichkeit der Verlängerung) amtieren. In der Geschichte der europäischen Integration hat sich der EuGH als ein wichtiger Motor dieses Prozesses erwiesen, da durch seine Entscheidungen europäisches Recht weiterentwickelt und normiert wurde. Aus demokratietheoretischer Sicht wird daher eine zu starke Macht der europäischen Judikative kritisiert, die umso schwerer wiegt, als dass die Entscheidungen des EuGH nicht transparent sind. Mit dem Vertrag von Lissabon sollten weitere Demokratisierungsschritte der EU vollzogen werden. Neben der Kodifizierung des „Ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens“ (Legitimität) sowie der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat (Effizienz) ist insbesondere die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) Ausdruck dieses Bestrebens. Mit einer erfolgreichen EBI wird die EU-Kommission dazu aufgefordert, einen europäischen Rechtsakt vorzuschlagen, was auch Änderungen bestehender Rechtsakte beinhalten kann. Dafür müssen in mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten innerhalb eines Jahres mindestens eine Million Unterschriften (Unterstützungsbekundungen) gesammelt werden. Diese vergleichsweise hohen Hürden konnten bislang nur von wenigen sehr gut vernetzen Initiatoren erfüllt werden; gleichwohl zeigen die Erfahrungen, dass im Kontext einer EBI auch durch die damit verbundene Öffentlichkeitswirkung Einfluss auf die europäische Politik ausgeübt werden kann. Europäischer Rat – das institutionalisierte Gipfeltreffen M 10. M 12 Gerichtshof der EU – der Schiedsrichter M 14, M 16 Bürgerbeteiligung durch die Europäische Bürgerinitiative (EBI) M 18, M 19 Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C . B uc hn r V er la gs | |
 « | 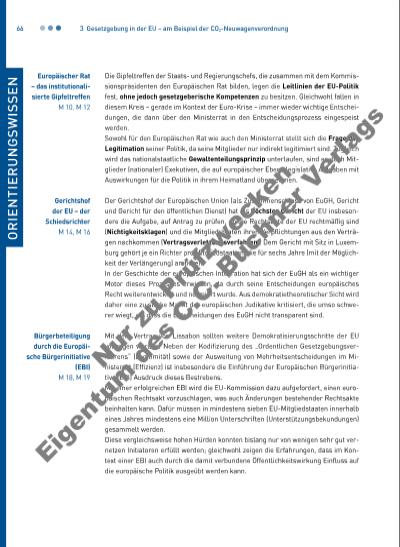 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |