| Volltext anzeigen | |
• Joschka Fischer (M2) gibt zu bedenken, dass, wenn man das Thema „Vertreibung“ erinnern wolle, es eingebettet sein müsse in den größeren Zusammenhang deutscher Selbstzerstörung. Dabei könne man allerdings nicht 1944 ansetzen, also mit dem deutschen Rückzug und dem Vormarsch der Roten Armee, sondern müsse viel früher beginnen. Zu berücksichtigen wären in diesem Zusammenhang etwa die Zerstörung der alten jüdischen Kultur und der deutsch-jüdischen Symbiose in Ostund Südosteuropa, dann aber auch die Zerstörung alter deutscher Städte und deutscher Minderheiten in Südostund Osteuropa. • Fischer geht es um den größeren Zusammenhang von Flucht und Vertreibung, den er mit der „deutschen Selbstzerstörung“ umreißt. Dabei spielt die Vorgeschichte – vor 1944 – eine entscheidende Rolle: Die Politik der Nationalsozialisten sprengte mit dem Holocaust, dem deutschen Angriffskrieg und dem Besatzungsterror jegliche Maßstäbe. So wäre der Zweite Weltkrieg mit seinen genozidalen Erscheinungsformen als Ursache für Flucht und Vertreibung einzubeziehen. • Schließlich spricht sich Steinbach zwar für eine Berücksichtigung anderer Vertreibungen in Europa aus, ihr Fokus liegt jedoch auf den deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, was sich auch in ihrem Eintreten für einen Sitz des geplanten Zentrums in Berlin zeigt. Demgegenüber plädiert Fischer mit Blick auf eine Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung gegen ein nationales Projekt in Deutschland und für eine enge europäische Zusammenarbeit. Zu Aufgabe 3a • Kulturkontakt-Theorien gehen davon aus, dass Menschen einer bestimmten Kultur angehören und als deren Vertreter zu sehen sind. Die Geschichte der Menschheit wird entsprechend als Abfolge von Kulturkontakten betrachtet. So wird zum Beispiel die Geschichte des Römischen Reiches als Geschichte der Verbreitung der römischen Kultur, also als „Romanisierung“, angesehen. • Gegen die Vorstellung einer einfachen „Übertragung“ von Kultur ist vielfach eingewendet worden, dass Kulturkontakt vielmehr immer eine Vermischung zur Folge habe. So habe das Römische Reich nicht nur seine Kultur verbreitet, sondern sei auch selbst durch den Kontakt mit anderen Kulturen verändert worden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich. Daher ist es treffender, von einer fortwährenden Geschichte des Kulturaustausches und der kulturellen Vermischung zu sprechen. Entsprechend gibt es keine „reinen“ Kulturen, sondern Kulturen sind immer das Ergebnis eines kontinuierlichen kulturellen Austausches. Zu Aufgabe 3b • Am ehesten auf die Vorgeschichte und Folgen von Flucht und Vertreibung passend scheint Urs Bitterlis Ansatz der „Kulturverfl echtung“. Hierunter versteht er ein länger dauerndes Zusammenleben und -wirken von Bevölkerungsgruppen verschiedener Kultur im selben geografi schen Raum. Zum einen lässt sich in der Vorgeschichte von Flucht und Vertreibung die multikulturelle Welt Mitteleuropas, wo griechisch-orthodoxe und armenische Christen, Katholiken und Protestanten, Altgläubige und Juden zusammenlebten, als ein Raum intensiver kultureller Verfl echtungen bezeichnen. Auch Joschka Fischer (M2) nimmt auf solche kulturellen Verfl echtungszonen in Ostund Südosteuropa Bezug. Diese wurden jedoch durch Völkermord und das Streben nach einer Homogenisierung von Nationalstaaten fast vollständig „entfl echtet“. 483 32017_1_1_2016_Kap5_470-496.indd 483 04.05.16 10:51 Nu r z Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d e C .C . B uc hn er V er la gs | |
 « | 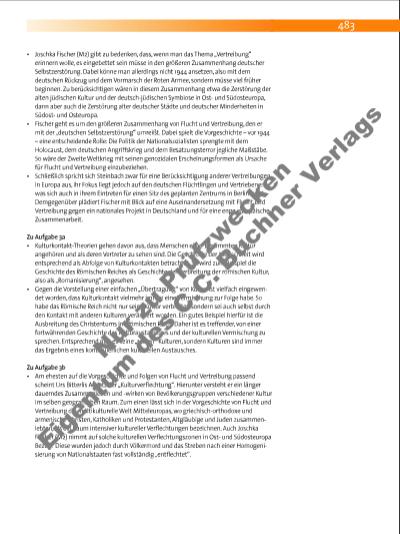 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |