| Volltext anzeigen | |
o Materialien veranschaulichen und vertiefen einzelne Aspekte, stellen kontroverse Sichtweisen dar und berücksichtigen alle relevanten Gattungen. o Arbeitsaufträge sind farblich gekennzeichnet. Sie verwenden die „Operatoren“ der drei Anforderungsbereiche des Zentralabiturs. Themen-, modulund semesterübergreifende Aufgaben sowie weitere kompetenzorientierte Arbeitsvorschläge sind zusätzlich ausgewiesen. Siehe hierzu ausführlich die Angaben vorne im Buch. u Theorie-Bausteine behandeln exemplarisch historische Theorien und Erklärungsmodelle und vernetzen die Module durch Querverweise und Arbeitsvorschläge miteinander. uu Methoden-Bausteine erläutern spezifi sche historische Arbeitstechniken an einem konkreten Beispiel. Ergänzt wird dies hinten im Buch durch eine Übersicht Methoden wissenschaft lichen Arbeitens. oo Kompetenzen testen Mit einem Rätsel 1 und handlungsorientierten Arbeitsaufträgen 2 lassen sich die angeeigneten Kompetenzen testen. Eine Abbildung zur Geschichtsund Erinnerungskultur 3 rundet die Seite ab. o Probeklausur Mithilfe der Klausur kann das erworbene Wissen zum Rahmenthema angewendet und überprüft werden. Praktische Hinweise zur Bearbeitung von Klausuren stehen hinten im Buch. 94 Nationalstaatsbildung im Vergleich M2 Eine Geste der Versöhnung In der „Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Brüder in Christi Hirtenamt“ vom 18. November 1965 heißt es: Hochwürdige Konzilsbrüder! Es sei uns gestattet, Ehrwürdige Brüder, ehe das [Zweite Vatikanische] Konzil sich verabschiedet, Ihnen, unseren nächsten westlichen Nachbarn, die freudige Botschaft mitzuteilen, dass im nächsten Jahre im Jahre des Herrn 1966 die Kirche Christi in Polen und mit ihr zusammen das gesamte polnische Volk das Millennium seiner Taufe und damit auch die Tausendjahrfeier seines nationalen und staatlichen Bestehens begehen wird. […] Nach alledem, was in der Vergangenheit geschehen ist – leider erst in der allerneuesten Vergangenheit –, ist es nicht zu verwundern, dass das ganze polnische Volk unter dem schweren Druck eines elementaren Sicherheitsbedürfnisses steht und seinen nächsten Nachbarn im Westen immer noch mit Misstrauen betrachtet. Diese geistige Haltung ist sozusagen unser Generationsproblem, das, Gott gebe es, bei gutem Willen schwinden wird und schwinden muss. […] Die Belastung der beiderseitigen Verhältnisse ist immer noch groß und wird vermehrt durch das sogenannte „heiße Eisen“ dieser Nachbarschaft; die polnische Westgrenze an Oder und Neiße ist, wie wir wohl verstehen, für Deutschland eine äußerst bittere Frucht des letzten Massenvernichtungskrieges zusammen mit dem Leid der Millionen von Flüchtlingen und vertriebenen Deutschen (auf interalliierten Befehl der Siegermächte – Potsdam 1945! – geschehen). […] Für unser Vaterland, das aus dem Massenmorden nicht als Siegerstaat, sondern bis zum Äußersten geschwächt hervorging, ist es eine Existenzfrage […]; es sei denn, dass man ein über 30-Millionen-Volk in den engen Korridor eines „Generalgouvernements“ von 1939 bis 1945 hineinpressen wollte – ohne Westgebiete; aber auch ohne Ostgebiete, aus denen seit 1945 Millionen von polnischen Menschen in die „Potsdamer Westgebiete“ hinüberströmen mussten. […] In diesem allerchristlichsten und zugleich sehr menschlichen Geist strecken wir unsere Hände zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Und wenn Sie, deutsche Bischöfe und Konzilsväter, unsere ausgestreckten Hände brüderlich erfassen, dann erst können wir wohl mit ruhigem Gewissen in Polen auf ganz christliche Art unser Millennium feiern. Wir laden Sie dazu herzlich nach Polen ein. Nach: Oskar Golombek (Hrsg.), Die katholische Kirche und die VölkerVertreibung, Köln 21968, S. 153 ff. 1. Diese Erklärung stieß auf sehr scharfen Widerstand bei der polnischen Regierung. Erörtern Sie, warum dieses Angebot der Versöhnung für die kommunistische Führung nicht akzeptabel war. 2. Entwerfen Sie aus Sicht der deutschen Bischöfe eine Antwort auf diese Erklärung. Vergleichen Sie anschließend Ihr Ergebnis mit dem tatsächlichen Antwortschreiben der Bischöfe vom 5. Dezember 1965 (siehe dazu den Code 7317-05). 5 10 15 20 o„Wir vergeben und bitten um Vergebung.“ Foto vom 4. November 2015, Breslau (Polen). Das Denkmal des Kardinals Bolesław Kominek, Verfasser des Hirtenbriefes, wurde in Breslau im Dezember 2005 neben der Kirche Maria am Sande eingeweiht. Die 4,35 Meter hohe Figur des Geistlichen wiegt zwei Tonnen. Sie hält in den Händen eine Taube, die symbolisch für den Frieden und für das Versöhnungsschreiben der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder steht. Am 29. Januar 2016 besuchte der deutsche Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel das Denkmal und legte dort gemeinsam mit dem Stadtpräsidenten von Breslau, Rafał Dutkiewicz, Blumen nieder. 25 30 35 40 98 Theorie-Baustein: Deutungen des deutschen Selbstverständnisses im 19. und 20. Jahrhundert Kompetenz: Sich mit Erscheinungsformen nationalen Denkens und Selbstverständnisses im 19. und 20. Jahrhundert auseinandersetzen sowie deren Deutungen analysieren Hinweis: Zum deutschen Selbstverständnis im 19. Jahrhundert siehe auch die Kapitel ab Seite 15, 29 und 39. Daneben informiert das Kapitel ab Seite 132 ausführlich über das deutsche Selbstverständnis nach 1945. Das deutsche Selbstverständnis im Wandel der Zeit Das deutsche „Selbstverständnis“ hat in den letzten 200 Jahren erhebliche Wandlungen erlebt. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Vorstellungen einer „Nation“ eng mit dem Liberalismus verbunden. Während des Kaiserreiches wurden nationale Vorstellungen zunehmend aggressiver als zuvor, hingen eng mit dem Imperialismus zusammen und entwickelten sich langsam in Richtung auf einen Reichsnationalismus (u M1). Im Nationalsozialismus verbanden sich dann hypernationalistische Vorstellungen mit einem mörderischen Rassismus. Nach 1945 war deshalb klar, dass diese Art von Nationalismus eine Sackgasse dargestellt hatte und neue Wege beschritten werden mussten. Allzu deutlich war auch geworden, dass Nationalismus zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen konnte, und ein erneuter Krieg in Europa mit Atomwaffen ausgetragen worden wäre. Kein Staat kommt ganz ohne ein „wir“-Gefühl aus. In welche Richtung konnten aber Nationsvorstellungen mit einem neuartigen demokratischen Selbstverständnis entwickelt werden? Bundesrepublik Deutschland und DDR Die beiden deutschen Staaten, die nach 1949 entstanden, sind sehr unterschiedlich mit dieser Frage umgegangen. Die Führung der DDR betonte zunächst vor allem den Internationalismus der Arbeiterbewegung und die Tradition des Widerstandes gegen den deutschen Faschismus. Allerdings blieben die Erfolge dieser Propaganda begrenzt. Sie konnte zwar bei Aufmärschen oder bei Parteiveranstaltungen in gewisser Weise mobilisierend wirken, war aber für die breite Masse der Bevölkerung zu abstrakt und knüpfte auch zu wenig an Alltagserfahrungen an. Zudem versuchte sich die DDR in den 1950er-Jahren von Westdeutschland abzusetzen, indem der Westen als militaristisches und (halb)faschistisches System dargestellt wurde (u M2 und M3). Anfangs stieß diese Propaganda auf einige Erfolge, weil in der Bundesrepublik tatsächlich zahlreiche ehemalige aktive Anhänger des NS-Regimes wieder öffentliche Funktionen ausübten. Langfristig war sie aber nur mäßig erfolgreich, weil in der DDR der westliche Rundfunk und später westliche Fernsehprogramme empfangen werden konnten, die ein völlig anderes Bild des Landes entwarfen. o „Deutschland – August 1914.“ Ölgemälde (192 x 147 cm) von Friedrich August von Kaulbach, 1914. p Beschreiben Sie die dargestellte Frauenfi gur und ihre Attribute. p Charakterisieren Sie die Stimmung, die das Gemälde transportiert. p Arbeiten Sie heraus, welches deutsche Selbstverständnis in dem Ölgemälde deutlich wird. Berücksichtigen Sie dabei auch den historischen Kontext. p Vergleichen Sie diese Germania-Darstellung mit derjenigen auf Seite 167 (M1). p Entwickeln Sie eine moderne Germania-Darstellung, in der sich Assoziationen zur deutschen Geschichte widerspiegeln. u Das Kyffhäuserdenkmal bei Bad Frankenhausen in Thüringen. Foto von 2012. p Die Architektur des Kyffhäuserdenkmals bietet dem Betrachter eine „stufenweise Abfolge der Geschichte“. Erläutern Sie diese Aussage in einem kurzen Aufsatz. Recherchieren Sie dazu im Vorfeld im Internet über das Denkmal. Rätsel Recherche und Präsentation Geschichtsund Erinnerungskultur Nationalstaatsbildung 1. Erläutern Sie anhand eines selbstgestalteten Schaubildes das Lösungswort des Rätsels. Weimarer Republik 2. Setzen Sie das politische System der Weimarer Republik mit der Demokratie in der Bundesrepublik nach 1949 in Beziehung. Recherchieren Sie dazu im Internet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Form einer Tabelle dar. Deutsches Selbstverständnis nach 1945 3. Charakterisieren Sie die Entwicklung des Verständnisses von Politik und Gesellschaft in der Bundesrepublik und der DDR zwischen 1949 und 1989. Tragen Sie Ihre Ergebnisse in einem Kurzreferat vor. 1. Deutscher Historiker, der das Werk „Der lange Weg nach Westen“ verfasste (Nachname) (3. Buchstabe) 2. Massenkundgebung für die Einheit und Freiheit Deutschlands im Jahre 1832 (2. und 13. Buchstabe) 3. Dieses Ereignis fand am 18. Januar 1871 in Versailles statt (3., 9. und 18. Buchstabe) 4. Dort tagte die deutsche Nationalversammlung 1848/49 in Frankfurt (2., 4. und 11. Buchstabe) 5. Polnische Gewerkschaft, die 1980 entstand und großen Einfl uss auf die politische Wende von 1989 hatte (4. und 5. Buchstabe) 6. Polnischer Nationalheld, Militär und Politiker (Vorname) (4. Buchstabe) 7. Polenfeindliche Politik, die in den 1880er-Jahren noch verschärft wurde (6., 19. und 20. Buchstabe) 8. Kanzler des Deutschen Reiches ab 1871 (Vorname) (2. Buchstabe) 9. Bezeichnung für die Zeit vor der deutschen Revolution von 1848 (5. Buchstabe) 10. Dort fand 1943 ein bewaffneter jüdischer Aufstand statt (14. Buchstabe) 11. Bezeichnung der Kriege, die Polen zwischen 1918 und 1921 führte (3. und 4. Buchstabe) Lösungswort: Zur Auswertung des Rätsels siehe Code 7317-12. 165Kompetenzen testen 95Deutsche und polnische Geschichte nach 1945 M3 Ein Bundeskanzler kniet nieder Bei seinem Besuch am 7. Dezember 1970 in Warschau legt Bundeskanzler Willy Brandt am Denkmal des Warschauer Ghettoaufstandes einen Kranz nieder und kniet – für die Betrachter und Journalisten völlig überraschend – fast eine Minute lang vor dem Denkmal. Diese für einen hochrangigen Politiker sehr ungewöhnliche Geste erregt weltweit erhebliches Aufsehen und trägt dazu bei, dass Willy Brandt 1971 den Friedensnobelpreis erhält. 1. Analysieren Sie, warum Brandts Kniefall als sensationell empfunden worden ist. 2. Vergleichen Sie die beiden Perspektiven der Fotos und stellen Sie dar, ob und inwieweit sich die Wirkung auf den Betrachter unterscheidet. 3. Brandts Geste löste in der Bundesrepublik heftige Reaktionen aus. Eine Zeitung fragte auf der Titelseite: „Durfte Brandt knien?“ Nehmen Sie dazu Stellung. 57Methoden-Baustein: Fotografi e Kompetenz: Fotografi en als historische Momentaufnahmen interpretieren Historische Momentaufnahmen Fotografi en prägen unser Bild von der jüngeren Geschichte mehr als jedes andere Medium. Sie halten politische und gesellschaftliche Ereignisse für die Nachwelt fest und geben uns eine Fülle von Informationen über den Lebensalltag. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Fotografi eren für breite Bevölkerungskreise erschwinglich. Fotos wurden dadurch für den Historiker zu einer immer wichtigeren Quelle. Fotografi en haben eine sehr starke suggestive Kraft, weil sie scheinbar die Welt so wiedergeben, „wie sie ist“, sie vermitteln den Eindruck von Authentizität. Mit dem Druck auf den Auslöser wird aber kein „objektives“ Bild der Wirklichkeit hergestellt. Fotos sind Momentaufnahmen und zeigen immer nur einen ausgewählten und bearbeiteten Ausschnitt aus der Realität. Bereits durch die Wahl des Motivs, des Bildausschnitts und der Perspektive stellt der Fotograf ein subjektives, „komponiertes“ Bild der Wirklichkeit her. Retuschen, Montagen und andere Manipulationen, etwa das Wegschneiden oder Vergrößern bestimmter Bildteile, machen die Fotografi e zu einer schwer zu beurteilenden Quelle. Bereits während des Amerikanischen Bürgerkrieges (1861 1865) wurden in amerikanischen Zeitungen Fotos von den Schlachtfeldern abgedruckt, die häufi g als schockierend empfunden wurden. Erst später wurde aber bekannt, dass der Fotograf die Leichen „arrangiert“ hatte, das heißt nach dem Ende der Schlacht neu und anders hingelegt hatte, sodass eine Wirkung entstand, die sonst nicht vorhanden gewesen wäre. Fotos müssen deshalb als Quelle besonders vorsichtig bewertet werden. Sie müssen unter bestimmten Fragestellungen interpretiert und in einen historischen Gesamtzusammenhang eingeordnet werden. Formale Kennzeichen p Wer hat das Foto gemacht, in Auftrag gegeben und veröffentlicht? p Wann, wo und aus welchem Anlass ist das Foto gemacht bzw. veröffentlicht worden? Bildinhalt p Wer oder was ist auf dem Foto abgebildet? Was wird thematisiert? p Welche Darstellungsmittel werden verwendet (Schwarzweißoder Farbbild, Kameraperspektive, Aufbau, Schnappschuss oder gestellte Szene, Profi oder Amateuraufnahme)? p Sind Hinweise auf Bildbearbeitung oder nachträgliche Veränderungen erkennbar (Retusche, Montage, Beschnitte bzw. Ausschnittvergrößerungen)? Historischer Kontext p Auf welches Ereignis oder welche Person bezieht sich das Foto? p Wie lässt sich das Foto in den historischen Kontext einordnen? Intention und Wirkung p Für wen und in welcher Absicht wurde das Foto gemacht bzw. veröffentlicht? p Welche Botschaft, welche Deutung vermittelt das Foto beabsichtigt oder unbeabsichtigt? p Welche Wirkung soll beim Betrachter erzielt werden? Bewertung und Fazit p Wie lässt sich das Foto insgesamt einordnen und bewerten? p Welche Auffassung vertreten Sie zu dem Bild? Hinweis: Das Buch bietet verschiedene Anwendungsbeispiele. Hier eine Auswahl geeigneter Fotografi en: Siehe Seite 51, 70, 80 und 95. Aufgabenstellung In einer Abiturklausur werden die Aufgaben zusätzlich zum Pfl ichtund Kernmodul eines Semesters ein Thema eines weiteren Semesters (Semesterübergriff) ansprechen, und Sie werden in Form einer offenen Frage Kenntnisse über ein Wahlmodul einbringen müssen. Im Abitur erhalten Sie unterschiedliche Aufgaben für gAund eA-Kurse (grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau). Pfl ichtund Kernmodul 1. Arbeiten Sie die nationalen Symbole heraus, die in M1 verwendet werden. Analysieren Sie anschließend ihre Bedeutung. 2. Interpretieren Sie die Selbstdarstellung (M2), die Jozef Piłsudski im Rückblick vornimmt. 3. Erörtern Sie, wie „polnisch“ oder wie „deutsch“ der Fußballverein Schalke 04 in den 1930er-Jahren war (M3). Nehmen Sie dazu Stellung, warum die Vereinsführung von Schalke 04 so viel Wert darauf legte, die deutsche Herkunft ihrer Spieler zu dokumentieren. Berücksichtigen Sie dabei das Jahr 1934. Wahlund Kernmodul 4. Fassen Sie die Überlegungen von Theodor Heuss (M4) mit eigenen Worten zusammen und kommentieren Sie die Botschaft der Rede. 5. Erörtern Sie, welches Selbstverständnis sich in der Rede von Heuss manifestiert. Ordnen Sie die Rede in den historischen Kontext ein und nehmen Sie dazu Stellung. Semesterübergriff 6. Erörtern Sie, inwiefern sich Heuss in seiner Rede mit Formen und Funktion von historischer Erinnerung auseinandersetzt. 166 Probeklausur: Wurzeln unserer Identität run 2. Ent wo Ihr M2 Eine Rätsel 1. Deut Nationa 1. Erlä des Theorie-Ba P ichtu 1. Arb ansc n: Fotografi e 1. An em 2 Ve 1 2 3 Nu r z u Pr üf zw ec ke n E g n d es C .C .B uc h er Ve rla gs | |
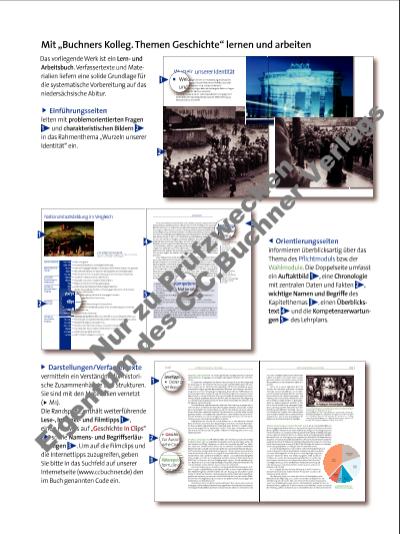 « | 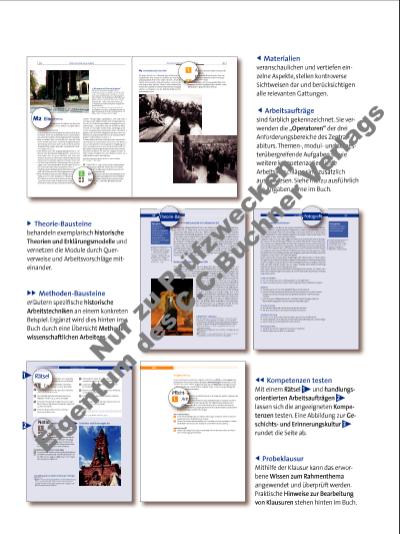 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |