| Volltext anzeigen | |
Ein Vaterland mit Pickelhaube? Die Ära von 1789 bis 1914 wird in der Geschichtswissenschaft als „langes 19. Jahrhundert“ verstanden, in dem sich die Moderne ihren Weg bahnte. Sie ist gekennzeichnet durch die Industrialisierung, den Wandel der Lebenswelt, eine fortschreitende Demokratisierung und die Bildung von Nationalstaaten. Auf der politischen Bühne Mitteleuropas dominierten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die beiden Großmächte Preußen und das Kaisertum Österreich. Zunächst waren sie Verbündete gegen das revolutionäre Frankreich, nach 1815 waren sie rivalisierende Partner im Deutschen Bund, dem Zusammenschluss der deutschen Staaten, der bis 1866 bestand. Im gleichen Jahr besiegte die preußische Armee Österreich im „Deutschen Bruderkrieg“, was den Ausschluss der bisherigen Führungsmacht aus der deutschen Politik bedeutete. Preußens Vorherrschaft erstreckte sich zunächst lediglich auf alle Staaten nördlich der „Mainlinie“. Im Vorzeichen eines preußisch-gesamtdeutschen Sieges über Frankreich 1870/71 beteiligten sich dann aber auch die süddeutschen Staaten an dem 1871 von den „verbündeten Regierungen“ geschaffenen Kaiserreich. Otto von Bismarck, seit 1862 preußischer Ministerpräsident und von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler, hätte die Deutschen freilich kaum „unter einen Hut“ gebracht, wenn er für Preußens Machtpolitik nicht auch die nationale Einheitsbewegung hätte nutzen können. Preußens Übergewicht in dem bis 1918 bestehenden Kaiserreich war unübersehbar. Zu Preußen gehörten 1871 60 Prozent der Reichsbevölkerung und 65 Prozent des Reichsterritoriums. Gegen Preußens Willen konnten die Regierungen der übrigen Bundesstaaten und auch der Reichstag in einem ernsten Konfl iktfall nichts durchsetzen. Aber der kleindeutsche Nationalstaat wurde trotz der Zugehörigkeit zum jeweiligen Einzelstaat als das größere Vaterland begriffen und begrüßt. Die doppelte Loyalität zum engeren und weiteren Vaterland wurde auch durch zwei seitliche kleine Kokarden in den Landesund Reichsfarben an den Pickelhauben der Soldaten verdeutlicht. Obwohl „Eisen und Blut“ entscheidend zur Reichsgründung beitrugen und die Verherrlichung des preußisch-deutschen Militärs zu einem Kennzeichen des Kaiserreiches wurde, blieb den Deutschen der Friede 43 Jahre lang erhalten. Das galt auch noch, als nach Bismarcks zurückhaltender Außenpolitik unter Kaiser Wilhelm II. Deutschlands Politiker im Zeichen neuen Prestigedenkens und Strebens nach Weltgeltung einen „Platz an der Sonne“ einforderten. Die politische Führung wollte für Deutschland eine Stellung als Weltmacht erobern; dazu gehörten auch eine gewaltige Flotte und ausgedehnter Kolonialbesitz. Immer mehr europäische Staaten, vor allem Großbritannien, wandten sich deshalb gegen das Deutsche Reich. Bündnisse und Rüstungsindustrien der großen europäischen Mächte bereiteten den Krieg vor, den Wilhelm II. und seine Berater leichtfertig herbeiführten, auch wenn ihnen nicht die Alleinschuld anzulasten ist. Die Dauer und die schrecklichen Opfer des Ersten Weltkrieges sollten dann selbst die schlimmsten Befürchtungen übertreffen. u Wie reagierten die deutschen Fürsten nach 1815 auf die Entwicklungen in Frankreich? u Welche Ursachen hatte die Revolution von 1848/49 und welche Ziele verfolgten ihre Befürworter und welche Ursachen hatte ihr Scheitern? u Welche positiven Auswir kungen auf die weitere politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland lassen sich trotz des Scheiterns feststellen? u Wodurch war die Innenund Außenpolitik des Kaiserreiches gekennzeichnet und welche Rolle spielte der Nationalismus für politische Entscheidungen? u Wer trug die Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs? 223Orientierung Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
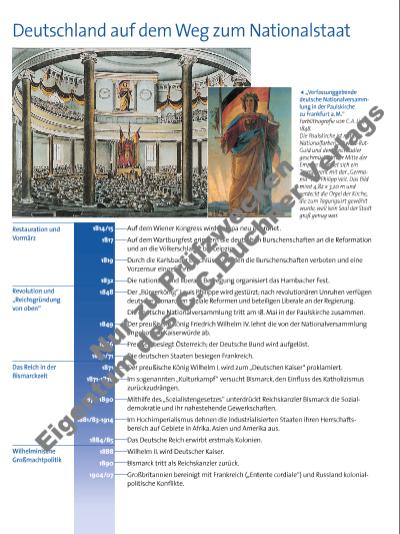 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |