| Volltext anzeigen | |
Amtszeit, durchbrochen. Konsulat und Prätur verkamen im Lauf der Expansion zunehmend zum Sprungbrett für anschließende lukrative Promagistraturen. Feldherren und Statthaltern eröffneten sich ungeheure Möglichkeiten der Bereicherung. Große militärische Leis tungen verschafften unvergleichbares Prestige. Nobiles, die als Promagistrate – im Osten gottähnliche – Verehrung und schrankenlose Macht genossen hatten, ließen sich nach Ablauf ihrer Kommandos zunehmend schwerer in den Senat integrieren. Dort wartete auf sie oft eine neiderfüllte Mehrheit. Denn dort hatten viele den Weg zu Macht, Reichtum und Ruhm durch Ämter (Prätur und Konsulat) nie erreicht. Die wachsende Ungleichheit untergrub ab 200 v. Chr. zunehmend Zusammenhalt und Machtbalance des Adels und damit die Fundamente seiner Herrschaft. Spätere soziale Spannungen hatten ihren Ursprung auch in dem Grundsatz, dass Geldgeschäfte nicht mit dem Ethos und der Würde der Nobilität vereinbar waren. Dementsprechend legte die lex Claudia von 218 v. Chr. ein Verbot von Steuerund Handelsgeschäften für diesen Stand fest. Der Teil der Oberschicht, der weiter Geldgeschäfte betreiben wollte, gehörte fortan dem von politischen Karrieren ausgeschlossenen Ritterstand an. Die lex Claudia zwang Senatoren, in landwirtschaftlichen Besitz zu investieren. Sicherheit und Ansehen dieser Anlage zogen auch die Ritter an. Beide Gruppen setzten dabei auf eine mit Sklaven betriebene Gutswirtschaft mit ausgedehnter Weidewirtschaft und intensivem Weinund Olivenanbau. Seit Roms Feldherren im 2. Jahrhundert zunehmend zu Massenversklavungen schritten, um ihre Kassen zu füllen, herrschte kein Mangel an Sklaven als billigen Arbeitskräften. Den Kleinbauern bereitete der oft jahrelange Kriegsdienst außerhalb Italiens schwere Probleme. Daraus resultierende Verschuldung und offene Gewalt der Gutsbesitzer zwangen immer mehr von ihnen zur Aufgabe. So endeten viele stolze Eroberer der Mittelmeerwelt am Ende in den elenden Reihen der besitzlosen und von staatlicher Getreideversorgung lebenden stadtrömischen Proletarier. Das barg sozialen Sprengstoff und gefährdete zudem Roms militärische Macht. Da nur wehrpfl ichtig war, wer ein Mindestvermögen für die Anschaffung der Waffen besaß, gingen der Weltmacht gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. zu sehends die Rekruten aus. Agrarund Heeresreform Im Jahr 133 v. Chr. legte der Nobilis Tiberius Gracchus als Volkstribun Vorschläge für eine Agrarreform zur Lösung des Kleinbauernund Militärproblems vor. Großgrundbesitz sollte grundsätzlich auf 125 Hektar beschränkt, darüber hinausgehender Besitz an Proletarier ausgegeben werden. Als führende Nobiles einen Senatsbeschluss und das Veto eines anderen Tribunen gegen das Vorhaben erwirkten, griff Tiberius zum doppelten Verfassungsbruch: Er setzte seinen gegnerischen Tribunkollegen per Volksbeschluss ab und brachte gegen alle Regeln seine Wiederwahl durch. Senatorische Gegner ließen Tiberius daraufhin ermorden. Dessen ungeachtet knüpfte sein Bruder Gaius 123 v. Chr. an Tiberius’ Politik an. Um sich abzusichern, übertrug er die Entscheidung über Todesurteile per Gesetz exklusiv der Volksversammlung. Dagegen reklamierte der Senat das Recht, den Staatsnotstand zu erklären und die Konsuln zur Tötung erklärter Staatsfeinde – auch ohne Ge richtsurteil – zu er mächtigen. Als der Senat diesen Beschluss gegen Gaius fasste, wählte der den Freitod. Die Auseinandersetzung um die Gracchischen Reformversuche spaltete die Nobilität dauerhaft in zwei Gruppen. Die Optimaten (lat. optimus: „der Beste“) wollten die herkömmliche Ordnung und den Senat als einzig legitimen Ort für politische Entscheidungen bewahren. Die Popularen (lat. populus: „das Volk“) suchten dagegen ihre Ziele als Tribunen oder Konsuln gegen die Senatsmehrheit mit Volksbeschlüssen durchzusetzen (u M4). i Träger eines Legionsadlers. Bronzestatue von einer Pferderüstung, 1. Jh. n. Chr. Zur Heeresreform des Marius gehörte auch eine Vereinheit lichung der Feldzeichen. So wurde der Adler – das Zeichen Jupiters – alleiniges Erkennungszeichen der Legion. Filmtipp: Rom. TV-Serie von Michael Apted, 2005. Die Serie zeichnet die Geschehnisse vom Vorabend des Bürgerkrieges (siehe Seite 36) bis zur Machtübernahme des Augustus in einer fi ktiven Geschichte nach. 35Die Römische Republik Nu zu P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 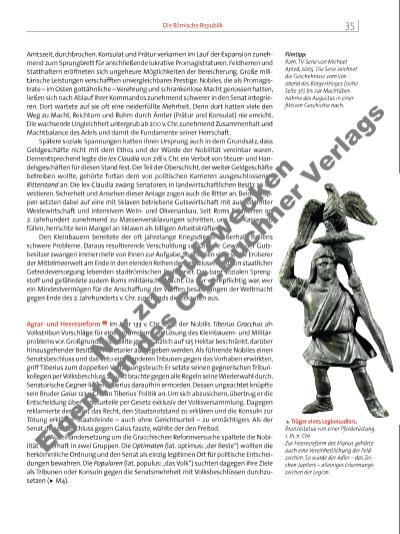 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |