| Volltext anzeigen | |
517Orientierung Welchen Weg nimmt die EU? Der Zusammenschluss von Staaten prägte die Geschichte Westeuropas seit dem Zweiten Weltkrieg und seit dem weltpolitischen Umbruch um 1990 die Geschichte ganz Europas. Im Lauf der Neuzeit hatten sich in Europa trotz vieler Unterschiede auch Gemeinsamkeiten in Kultur, Politik und Wirtschaft entwickelt. Dazu gehörten das Erbe der Antike und das Christentum ebenso wie die Freiheit des Handels und die Unabhängigkeit der Völker. Dabei versuchten die europäischen Staaten bis zum 20. Jahrhundert nicht, sich politisch zusammenzuschließen. Dies änderte sich in der Notlage nach den beiden Weltkriegen. Der erste Zusammenschluss war der Europarat 1949, in dem zunächst zehn Staaten politische Vereinbarungen trafen. Er hat mit seinen heute 47 Mitgliedern viel für Menschenrechte und Demokratie bewirkt, jedoch blieb er eine intergouvernementale Vereinigung. Die Staaten verhandeln miteinander, haben aber noch keine Souveränitätsrechte abgetreten. Die erste supranationale Institution, der Hoheitsrechte übertragen wurden, war die 1951 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). In ihr vereinigten sich die Benelux-Staaten (Belgien, Luxemburg, Niederlande), die Bundesrepublik, Frankreich und Italien. Die EGKS traf auf dem Feld der Kohleund Stahlpolitik Entscheidungen, die für die sechs Staaten rechtsverbindlich waren. Diesem supranationalen Integrationskern wurden andere Wirtschafts-, dann Politikbereiche und weitere Staaten angegliedert. So begründete die EKGS 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die einen gemeinsamen Markt schuf. Staaten Nordund Südeuropas schlossen sich an. Der Binnenmarkt war 1993 weitgehend verwirklicht. Die wirtschaftliche Integration setzte sich mit der Osterweiterung der Europäischen Union (EU) fort; als EU werden die Gemeinschaften seit der Neuordnung 1993 bezeichnet. Zugleich begründete ein Teil der EU eine Währungsunion, die mit der Einführung des EuroBargelds 2002 vollendet war. Die 28 Staaten der EU (Stand seit 2013) ringen bis heute um ein wirkungsvolleres Handeln nach Innen und Außen. Denn Europa hat global bisher nicht das Gewicht, das seiner Wirtschaftskraft entspricht. Die supranationalen Organe der EU, vor allem das Europäische Parlament, fordern mehr Entscheidungsbefugnisse, um die politische Einheit Europas zu stärken. Jedoch bestimmen noch immer die Einzelstaaten das Tempo der Einigung, indem sie wichtige Entscheidungen zur weiteren Integration nur einstimmig treffen. Die Integration wird auch auf anderen Ebenen vorangetrieben. So intensivieren beispielsweise europäische Forschungseinrichtungen, Kooperationen europäischer Firmen und Bildungsprogramme die Zusammenarbeit jenseits nationaler Grenzen und fördern die Verständigung. Die EURO-Rettungspolitik im Zuge der Griechenland-Krise seit 2010 sowie die Flüchtlingsströme, die in Folge des Bürgerkriegs in Syrien Europa seit dem Sommer 2015 erreichten, legten aber auch Konfl iktlinien innerhalb der EU bloß und werden die Staatengemeinschaft weiterhin vor eine Probe stellen. u Welche Entwicklungsstufen und Triebkräfte steuerten die europäische Integration? u Wie lassen sich Entscheidungsstrukturen der Europäischen Union in Vergangenheit und Gegenwart beurteilen? u Vor welchen Herausforderungen steht der europäische Einigungsprozess heute? Nu r z u Pr üf zw e ke n Ei ge tu m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 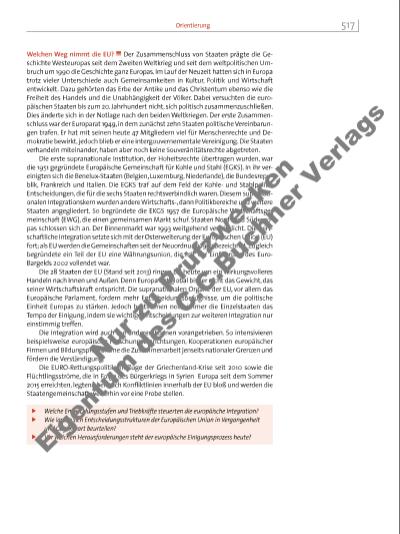 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |