| Volltext anzeigen | |
Die Übergänge der drei Interpretationsebenen sind gleitend; jede baut auf der anderen auf (Sache – Problem – Modell): „Die einzelnen Interpretationsebenen sind nicht isolierbar, nicht jeweils nur auf eine Stufe zu beschränken.“ 19 Grundsätzlich werden sie in der Literatur bisher den verschiedenen Entwicklungsstufen der Schüler zugeordnet: Jahrgangsstufe 9 wird traditionell als Übergangphase zwischen sachund problemorientierter Interpretation gesehen; durch das Vorziehen thematischer Lektüre in die Mittelstufe lässt sich – freilich neben der sachund problemorientierten – bereits auch die modellorientierte Interpretation einbeziehen. Auswahl und Abfolge der Themen in „Leben, Lieben, Lästern“ sind so angelegt, dass alle drei Interpretationsebenen zu ihrem Recht kommen. Dabei muss nach dem Prinzip der Steigerung vorgegangen werden: Ausgangspunkt sollte eine primär sachorientierte Interpretation sein, die sich im ersten Drittel mit dem Schwerpunkt „Leben“ auch anbietet. „Der Lektüre werden hier Texte zu Grunde gelegt, in denen das „sachliche“ Angebot überwiegt, die aber auch eine innere, persönliche Begegnung des Schülers mit den dargestellten In halten ermöglichen, sei es mit der Wirkung der Identifikation oder mit der der Dis tan zie rung.“ 20 Im Kapitel 3, „ Haare und Styling“, beispielsweise lassen sich den Auszügen aus Ovids Ars amatoria und Amores kulturgeschichtliche Informationen entnehmen. So gibt Text C Auskunft, dass man zu Ovids Zeit Folgendes kannte: Techniken des Haarefärbens (tingere, v. 2; medicare, v. 1) ein „Brennen“ (urere, v. 3) zu Zwecken des Stylings Perücken – evtl. gearbeitet aus Haaren germanischer Gefangener (captivos mittet Germania crines, v. 8) Zum Teil werden diese Informationen durch die anderen Texte des Kapitels bestätigt, zum Teil werden sie um neue Aspekte bereichert. In solchen sachorientierten Einheiten bietet es sich natürlich an, Informationstexte beizugeben (z.B. zum Färben, zum „Brennen“) oder Rechercheaufgaben zu stellen (z.B. zum Thema Männerfrisuren oder Entwicklung der Frisurmode im Verlauf der Antike). Karl Wilhelm Weebers Band „Alltag im alten Rom“ 21 kann hier als Grundlage dienen: Bei der Lektüre des entsprechenden Lexikonartikels sehen die Schüler, dass die gelesenen antiken Texte Quellen sind für die Sachinformationen, die wir heute haben. 9 19 Maier, 139. 20 Maier, 135. 21 Weeber, K.-W.: Alltag im alten Rom. Ein Lexikon, Zürich 52000. | |
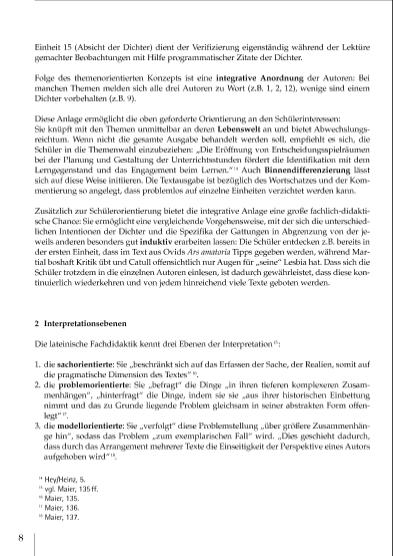 « | 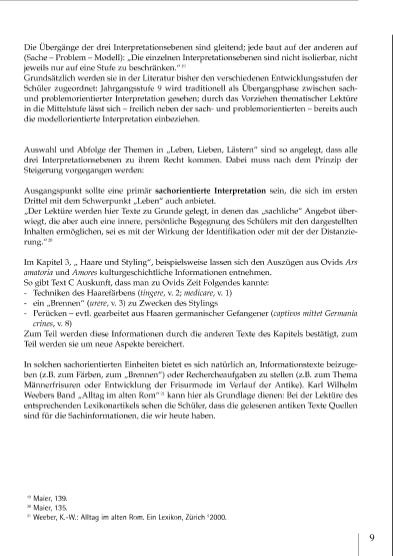 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |