| Volltext anzeigen | |
Christentum und Römisches Reich 49 Angesichts der politisch brisanten Lage in Judäa stellte sich für die Christen von Anfang an die Frage, wie sie zum römischen Staat standen. Um die Ausbreitung des Christentums nicht zu behindern, hatte bereits Paulus gefordert, den Trägern staatlicher Gewalt Gehorsam zu leisten, da sie von Gott eingesetzt seien. Auch in anderer Hinsicht wurde das Römische Reich von den Christen anerkannt: So wurde auf das Zusammentreffen des Prinzipats unter Augustus und der Geburt Christi hingewiesen. Dabei blieben die Christen ihren eigenen religiösen Geboten und Vorstellungen treu. Das bedeutete unter anderem, dass viele Christen im Hinblick auf das erwartete Leben nach dem Tod dem Diesseits gleichgültig oder distanziert gegenüberstanden. Diese Einstellung beförderte ebenso wie die Abgeschlossenheit des Kultes und die Verweitum hatte allerdings zunächst noch keine planmäßigen antijüdischen Aktivitäten zur Folge. Christliche Theologen hofften auf eine Bekehrung der Juden oder darauf, dass ein Rest von ihnen in der Endzeit gerettet werde. Als christliche Kaiser an die Macht kamen, begann sich das Problem zu verschärfen. Denn aus einer theologischen Auseinandersetzung konnte nun konkrete Politik werden. Die Spannung der kaiserlichen Politik zwischen Privilegierung, Schutz und Schikane kennzeichnet den staatlichen Umgang mit den Juden in Spätantike und Mittelalter bis in die Neuzeit. Kaiser Konstantin (306–337) gewährte jüdischen Synagogenvorstehern, Presbytern und hohen geistlichen Würdenträgern Privilegien, die auch später mehrfach erneuert wurden. Noch nachdem das Christentum Staatsreligion geworden war,1) erlaubte Kaiser Theodosius I. (347–395) ausdrücklich das Judentum als einzige nichtchristliche Religion. Seit 397 verboten mehrere Gesetze Gewalt gegen Juden sowie die Plünderung, Enteignung und Zerstörung von Synagogen. Für bereits erfolgte Fälle sollte Ersatz geleistet werden. Dies zeigte zwar einerseits den rechtlichen Schutz der Juden, stellte aber andererseits wiederkehrende antijüdische Ausschreitungen der städtischen Bevölkerung unter Beweis. Die Macht der Kaiser reichte oftmals nicht aus, solchen Ausbrüchen Einhalt zu gebieten. Zudem konnten sie auf den Widerstand kirchlicher Amtsträger stoßen: Der Versuch von Kaiser Theodosius I., eine von Christen zerstörte Synagoge wiedererrichten zu lassen, scheiterte am Widerstand des Mailänder Bischofs Ambrosius (374–397). Es gab aber auch eine antijüdische Gesetzgebung christlicher Kaiser, die die Lebensbedingungen der Juden verschlechterte. So durften sie keine christlichen Sklaven besitzen. Die Ehe zwischen Christen und Juden wurde untersagt, seit 388 sogar mit dem Tode bestraft. Außerdem wurde den Juden die Ausübung ziviler und militärischer Ämter im Staatsdienst verboten, wenig später auch die Betätigung als Anwälte bei Gericht. Im Jahre 423 wurde der Bau neuer Synagogen untersagt. Christliche Prediger und kirchliche Gesetzgebung zielten noch stärker als die weltliche auf eine Abgrenzung von Juden und Christen, ein Beispiel hierfür ist das mehrfach wiederholte Verbot gemeinsamer Mahlzeiten. Es muss aber hervorgehoben werden, dass auch Heiden und Häretiker2) in der weltlichen Gesetzgebung der Kaiser nicht besser behandelt worden sind. Die ersten Christenverfolgungen 1) vgl. auch Seite 54 2) Anhänger einer Häresie; Häresie (griech. „Wahl, Neigung“): von der kirchlichen Lehre abweichende Glaubensauffassung Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
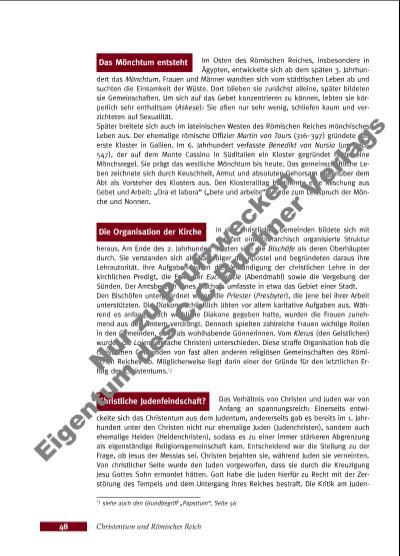 « | 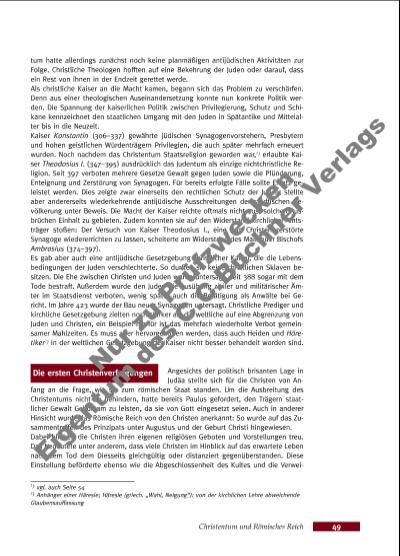 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |