| Volltext anzeigen | |
Christentum und Römisches Reich 51 In der Regel führten die Christen bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts ein vergleichsweise sicheres Leben. Vom Kaiser zentral angeordnete und organisierte Verfolgungen gab es erst danach: Die Krise des 3. Jahrhunderts veranlasste erstmals Kaiser Decius (249–251), bei seinem Regierungsantritt von allen Bewohnern des Römischen Reiches ein Opfer für die römischen Götter zu verlangen. Dies war die erste umfassende Zwangsmaßnahme in Religionsfragen. Decius sah einen Grund für die Krise in der nachlassenden Beachtung der altrömischen Traditionen und mangelnden Verehrung der altrömischen Götter. Daher wollte er deren Wohlwollen wiederherstellen und sich zugleich der Loyalität seiner Untertanen versichern. Wer sich dem Opfer verweigerte, dem drohten Inhaftierung, Vermögensverlust und Verbannung, seltener auch Folterung und sogar der Tod. Da die Christen die größte Gruppe der Verweigerer ausmachten, war das „Opferedikt“ Auslöser der ersten systematischen Christenverfolgungen. Sie endeten aber bereits nach kurzer Zeit, da sich die Römer gegen den Einfall der Goten wehren mussten. Die erste reichsweite Christenverfolgung Wenige Jahre später gab es eine erneute Verfolgung unter Kaiser Valerian (253– 260), der sich gezielt gegen die christlichen Kleriker sowie Christen in der römischen Oberschicht und im kaiserlichen Beamtenapparat wandte. Er wollte das Christentum besiegen, indem er dessen Führungsschicht bekämpfte. Sein Sohn und Nachfolger Gallienus hob die Edikte seines Vaters jedoch auf, gab beschlagnahmten Kirchenbesitz zurück und gestattete erstmals den Klerikern, ihren religiösen Verpflichtungen nachzugehen. Nach Valerians Tod blieben die Christen für ein knappes halbes Jahrhundert weitgehend von Gewaltmaßnahmen verschont, bis insbesondere im Osten des Römischen Reiches unter Diokletian und seinem Mitkaiser Galerius die letzten und blutigsten Verfolgungen stattfanden (303–311). Auch Diokletian sah in der Befolgung altrömischer Vorbilder in Sitten und Religion eine Voraussetzung für den Bestand des Römischen Reiches. Von seinen Maßnahmen waren anfangs nur Kirchengüter, wenig später dann auch die Kleriker betroffen. Schließlich aber wandte sich die Macht des Staates gegen alle Christen. Zerstörung von Kirchen und Schriften drohten ebenso wie Zwangsarbeit und Todesstrafe für jene, die sich einem Opfer verweigerten. Auch die Christen unter den Angehörigen der Oberschicht blieben nicht verschont, sondern wurden mit Verlust von Rang und Würde bestraft. Das Ziel war die Zerschlagung der Organisation, der geistlichen Leitung und der geistigen Fundamente der christlichen Kirche. Das Vorgehen gegen die Christen war von großer Grausamkeit gekennzeichnet. Manche von ihnen starben für ihren Glauben. Andere überlebten zwar, waren aber durch Folter und Verstümmelungen gezeichnet. Die Leidensbereitschaft der Christen nötigte auch vielen Römern Respekt ab. Sie konnte unterschiedlich gedeutet werden: als öffentliches Bekenntnis, als Nachfolge Jesu oder als Voraussetzung himmlischen Lohnes nach dem Tod für die erlittenen Schmerzen. Seit dem 2. Jahrhundert ist eine Verehrung der Zeugen des Glaubens (Märtyrer) erkennbar. An ihren Gräbern wurden Kirchen errichtet. Allerdings blieben keineswegs alle Christen standhaft. Die Mehrheit der Gläubigen opferte den Göttern und Kaisern und fiel so zumindest vorübergehend vom Glauben ab. Die Christen unter Diokletian Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um de s C .C .B uc hn r V er la gs | |
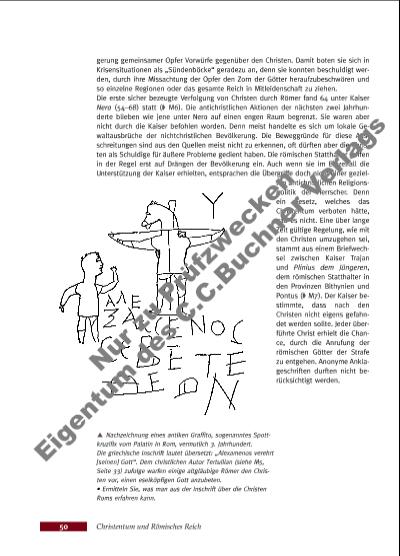 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |