| Volltext anzeigen | |
Christentum und Römisches Reich 53 Aber das Christentum hatte noch nicht gesiegt. Denn im Jahre 361 bestieg Julian den Kaiserthron. Er war christlich erzogen worden, hatte sich nach seinem Herrschaftsantritt aber offen dem Heidentum zugewandt. Daher verliehen ihm christliche Historiker den Beinamen „Apostata“ („Abtrünniger“). Offiziell bekannte er sich zu religiöser Toleranz, tatsächlich versuchte er jedoch mit unterschiedlichen Maßnahmen, die Vorherrschaft des alten Götterglaubens wiederherzustellen. Er strich Privilegien für christliche Kirchen, nahm staatliche Unterstützung zurück und öffnete die geschlossenen Tempel wieder. 362 erließ er ein Edikt, in dem er christlichen Lehrern untersagte, an den Schulen Werke der klassischen (paganen: „heidnischen“) Literatur zu unterrichten. Höhere Schulbildung, die unter anderem aus diesem Fach bestand, war Voraussetzung für eine Karriere im Staatsdienst. Julian erkannte also, welche große politische Bedeutung der Bildung Jugendlicher zukam. Bevor sich die Rückkehr zu den alten Göttern dauerhaft hätte durchsetzen können, starb Julian nach lediglich achtzehn Monaten an der Macht im Jahre 363 auf einem Perserfeldzug. Seitdem hatte das Römische Reich nur noch christliche Kaiser. Diese verfolgten eine intolerante Politik. Kaiser Gratian (375–383) wandte sich mit seinen Maßnahmen insbesondere gegen die alten Kulte der Stadt Rom. So ließ er den Grundbesitz der Tempel enteignen, strich Zuwendungen und untersagte Vermächtnisse an Tempel. Außerdem ließ er 382 aus der Senatskurie einen Altar der Göttin Victoria entfernen, die nicht nur den Sieg, sondern auch die Weltherrschaft Roms versinnbildlichte. Nach dem Tod Gratians sah der hoch angesehene römische Stadtpräfekt Symmachus die Gelegenheit, mit einem Brief beim erst dreizehnjährigen Kaiser Valentinian II. um Rückgabe des Altars zu bitten (➧ M9). Der Eindruck, den er mit seinem Schreiben hinterlassen hatte, war wohl so stark, dass die Berater des Kaisers dem Ansinnen nachgeben wollten. Es ist dem entschiedenen Einspruch des Mailänder Bischofs Ambrosius zuzuschreiben, dass sich Valentinian II. dann doch gegen die religiöse Toleranz Rückkehr zum alten Götterglauben? quenzen aus seinem Glauben an den neuen Gott. Auf den von ihm geprägten Münzen berief er sich auch noch nach dem Sieg über Maxentius auf die Unterstützung verschiedener heidnischer Götter, insbesondere auf den Sonnengott. Diesen, so scheint es, hat Konstantin mit dem christlichen Gott gleichgesetzt. 321 erklärte er den Tag der Sonne („Sonntag“) zum wöchentlichen Feiertag. Die Geburt Jesu wurde nun am Festtag des Sonnengottes, dem 25. Dezember, gefeiert. Trotz der Bevorzugung des Christentums ließ Konstantin es lange Zeit nicht auf eine offene Konfrontation mit dem Heidentum ankommen, da er sich damit gegen die Mehrheit der Reichsbevölkerung gestellt hätte. Insbesondere in Rom zeigte er seine Unterstützung für das Christentum nur vorsichtig. Erst kurz vor seinem Tod ließ er sich taufen. Dies war kein Zeichen des Zweifels, sondern damals nicht unüblich, da mit der Taufe die einmalige Sündenvergebung verbunden war. Unter den Söhnen und Nachfolgern Konstantins verschärfte sich die Gesetzgebung gegen die Heiden. Zur Zeit von Kaiser Constans wurden im Westen des Römischen Reiches die Opfer untersagt und die Tempel geschlossen, unter Constantius II. 353 die alten Kulte verboten. Die Gesetze verdeutlichen, welche Politik die christlichen Kaiser eigentlich verfolgen wollten. Die genannten Verbote ließen sich aber nicht durchsetzen, denn im Römischen Reich fehlten hierfür die Machtmittel. Es gab keine Strafverfolgungsbehörden, die auf die Einhaltung der Gesetze hätten achten können. N r z u Pr üf zw ec k n Ei g n um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
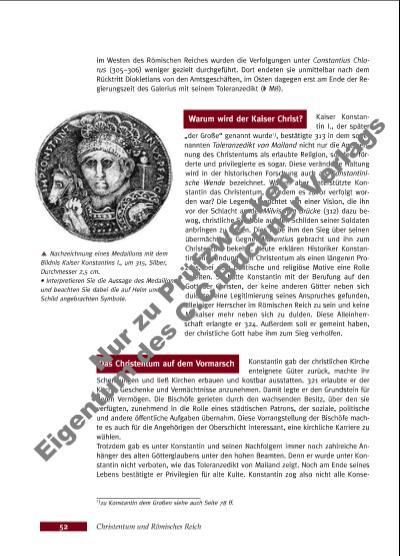 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |