| Volltext anzeigen | |
Das Römische Reich zwischen Krise und Umgestaltung 69 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1) beschlagnahmt 2) Landgüter, die mit ihrem Grundbesitz das Vermögen der Kurialen bildeten M13 Die Situation der Kurialen Der aus Ungarn stammende Althistoriker Géza Alföldy schildert die Situation der Kurialen, der Stadträte in den spätantiken Städten des Römischen Reiches. Sie wurden aufgrund ihres Vermögens automatisch Mitglied im Stadtrat ihrer Heimatgemeinde. Die Freiheit der Kurialen wurde stark eingeschränkt. Sie durften ihre Gemeinde nur mit Genehmigung des Statthalters verlassen, selbst wenn sie etwa in Angelegenheiten der Stadt den Kaiser besuchen wollten; falls sie mehr als fünf Jahre abwesend waren, wurde ihr Vermögen konfisziert1); es wurde ihnen sogar verboten, sich auf ihrem Gut außerhalb der Stadt für die Dauer niederzulassen; selbst für den Verkauf des eigenen Gutes2) benötigten sie eine Genehmigung durch den Statthalter. Am schlimmsten waren für sie jedoch ihre Leistungspflichten. Die Kurialen waren in ihrer Stadt für die Getreideversorgung, für die öffentliche Ordnung und für die öffentlichen Bauwerke verantwortlich und muss ten [...] öffentliche Spiele finanzieren; darüber hinaus mussten sie die Finanzen ihrer Gemeinde führen und bei Schulden die volle Haftung übernehmen; und vor allem wurde die Eintreibung der Kopfund Bodensteuer in der Gemeinde ihnen übertragen und zwar mit der Androhung strenger Strafen bei Versäumnissen und mit der Vorschrift der persönlichen Haftung für die Einnahmen. Als „Tyrannen“ erschienen sie ihren Mitbürgern insbesondere wegen dieser letzten Verpflichtung, und dieser Schachzug der kaiserlichen Politik, sie in der eigenen Gemeinde zu Steuereintreibern zu machen, trug zur Verschärfung der sozialen Gegensätze im spätrömischen Reich erheblich bei. Aber durch diese Verpflichtung, die unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen des spätrömischen Reiches keineswegs immer erfüllt werden konnte, waren die Kurialen selbst ebenfalls ein Opfer des Staates. [...] Viele Kurialen zogen die Konsequenz und bemühten sich auf verschiedenen Wegen, ihren Lasten zu entrinnen. Die Flucht der Kurialen aus den Städten war ein wiederholtes Objekt der spätrömischen Gesetzgebung [...]. In der Tat konnten die wiederholten Verfügungen die Entvölkerung der Kurien3) nicht unterbinden. [...] In den achtziger Jahren des 4. Jahrhunderts schrieb der [Schriftsteller] Libanios, dass in seiner Heimatstadt Antiochia in Syrien, wo es früher 600 oder gar doppelt so viele Kurialen gegeben hatte, nicht einmal 60 mehr zu finden seien. [...] Aus dem Jahre 445 gibt es die Anordnung, dass der Ordo einer Stadt4) auch dann als arbeitsfähig zu betrachten sei, wenn er nur drei Kurialen aufweist. [...] Selbst wenn die Entvölkerung der Kurien nicht immer auf unerträgliche Verpflichtungen zurückzuführen war, und selbst wenn die Lage in verschiedenen Teilen des Reiches recht unterschiedlich sein konnte, war der geschilderte allgemeine Trend nicht aufzuhalten. Géza Alföldy, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 31984, S. 165 f. 1. Nennen Sie die Verpflichtungen der Kurialen in ihrer Heimatgemeinde. 2. Erläutern Sie die Vorteile, die sich für Kaiser und Reichsverwaltung aus diesen Verpflichtungen ergaben. Welche Probleme entstanden umgekehrt aus der „Kurialenflucht“? 3. Im Hinblick auf die Situation der Kurialen und Pächter wird das Römische Reich des 4. und 5. Jahrhunderts auch häufig als „Zwangsstaat“ bezeichnet. Nehmen Sie unter Berücksichtigung von M12 (Seite 67 f.) zu diesem Begriff Stellung. 3) Stadträte 4) Gemeint ist der Stadtrat. Nu zu P rü fzw ec ke n Ei g nt u d s C .C .B u hn r er la gs | |
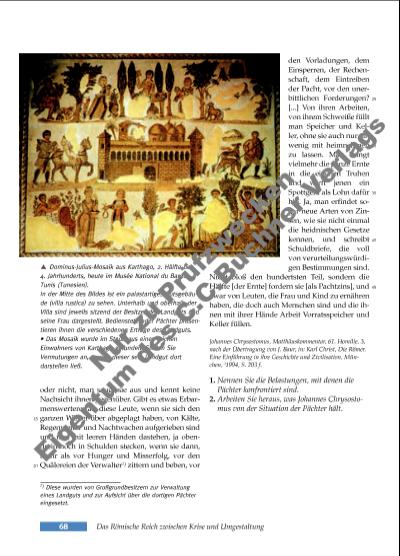 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |