| Volltext anzeigen | |
Das Römische Reich zwischen Krise und Umgestaltung 79 Konstantin setzte die unter Diokletian begonnene Neuordnung des Reiches fort. Bei der Abwehr der Beutezüge und Ansiedlungsversuche germanischer Stämme an Rhein und Donau bewährten sich die schon unter Diokletian verstärkten Grenzbefestigungen und die Aufteilung der Armee in Grenzund Feldtruppen. Die Grenztruppen wurden immer mehr zu einer Miliz bewaffneter Bauern. In der Feldarmee vertraute Konstantin dagegen auf mobile Reitertruppen, zu denen viele Germanen gehörten. Während die Nordgrenze des Reiches unter Konstantin zunächst ruhig blieb, sah es im Osten anders aus: Hier war das Verhältnis zum Perserreich nach Ablauf des unter Diokletian geschlossenen Friedensvertrages angespannt, weil beide Großmächte um die Kontrolle Armeniens und die Vorherrschaft im Nahen Osten konkurrierten. Ab 359 kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Persern. Den Kaiserhof baute Konstantin zum Zentrum des Reiches aus, in dem alle Fäden zusammenliefen. Hier entschied der Kaiser im Staatsrat gemeinsam mit seinen Ministern über die Regierungspolitik und erließ die Gesetze, mit denen er den umfangreichen Verwaltungsapparat steuerte (➧ M11). Der Kaiserhof und alle seine Institutionen galten als „heilig“ (sacrum) und erhielten damit eine geheimnisvolle, unangreifbare Autorität. Verstärkt wurden seit Konstantin auch wieder Senatoren in die Reichsverwaltung berufen, die unter Diokletian noch von allen wichtigen Ämtern ausgeschlossen gewesen waren. Noch konsequenter als Diokletian achtete Konstantin auf einer Trennung von militärischer und ziviler Verwaltung. Zu Oberbefehlshabern der Armee ernannte er zwei Heermeister (magister militum). Diese waren die Vertreter des Kaisers in allen militärischen Angelegenheiten. Das von Diokletian eingeführte Steuersystem blieb unter Konstantin im Wesentlichen bestehen. Er verlängerte aber den Zeitraum für die regelmäßige Neufestsetzung der allgemeinen Grund-Kopf-Steuer auf 15 Jahre und führte eine neue Sondersteuer, das sogenannte Krongeld, ein. Im Unterschied zu anderen Steuern durfte es nicht in Naturalien, sondern nur in Gold und Silber gezahlt werden. Das durch das Krongeld eingenommene Edelmetall verwendete Konstantin außer zur Finanzierung der Armee vor allem für die Prägung einer neuen Goldmünze. Sie wurde Solidus1) genannt und ersetzte die bisherigen Goldmünzen, deren Wert aufgrund des häufigen Mangels an Edelmetall in der kaiserlichen Kasse stark geschwankt hatte. Der Solidus blieb in der Folgezeit weitgehend wertstabil und war bis ins 11. Jahrhundert eine der wichtigsten Münzen in Europa und im Nahen Osten. Fortsetzung der Reformpolitik 1) solidus (lat.): echt, beständig, dauerhaft Am 11. Mai 330 weihte Konstantin an der Stelle des alten Byzanz und heutigen Istanbul eine neue Stadt ein: Konstantinopel. Der Ort war unter wirtschaftlichen und strategischen Gesichtspunkten sehr gut gewählt. Hier kreuzten sich der Landweg von Europa nach Asien und der Seeweg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. Die bedrohten Grenzen an der Donau und zum Perserreich waren gleichermaßen rasch zu erreichen. Außerdem war die auf einer Halbinsel gelegene Stadt besonders gut zu verteidigen. Schon die geplante Größe Konstantinopels machte deutlich, dass es sich nicht einfach um eine weitere Kaiserresidenz handelte, sondern um das neue Machtzentrum des Reiches, ein „Neues Rom“. Die Bewohner genossen die gleichen Privilegien wie die Die Gründung Konstantinopels Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge tu m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
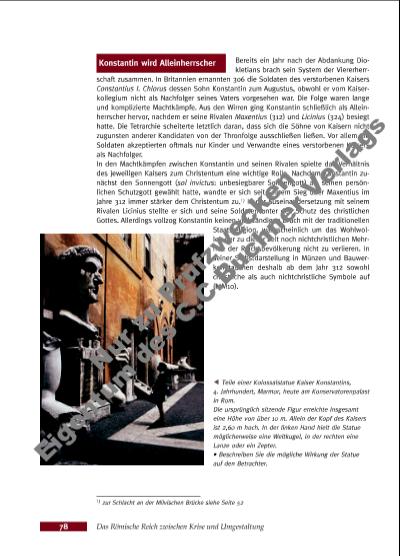 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |