| Volltext anzeigen | |
Das Römische Reich zwischen Krise und Umgestaltung 83 1) siehe hierzu auch Seite 73 In den über 2000 Städten des Römischen Reiches waren die Kurialen im 4. und 5. Jahrhundert mit ihren Ämtern, zu deren Übernahme sie aufgrund ihres Vermögens verpflichtet waren, hoffnungslos überfordert. Die ihnen abverlangten finanziellen Leistungen und die Haftungspflicht für die Steuerzahlungen ihrer Heimatstädte hatten diese städtische Oberschicht ruiniert.1) Die kaiserliche Gesetzgebung versuchte erfolglos, die Flucht der Kurialen aus ihren Ämtern zu verhindern und sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu zwingen: Die Zugehörigkeit zum Kurialenstand wurde erblich, die Kurialen durften ohne Genehmigung weder ihre Städte verlassen noch ihren Besitz verkaufen, der Eintritt in die Armee oder in die Reichsverwaltung wurde ihnen verboten. Trotz dieser Zwangsmaßnahmen löste sich der Kurialenstand im 4. und 5. Jahrhundert allmählich auf (➧ M13). Viele der Aufgaben der Kurialen in den Städten übernahmen die christlichen Bischöfe. Sie kümmerten sich um das Bauwesen, die Rechtsprechung und die Armenfürsorge. In den Krisenzeiten der Germanenund Hunneneinfälle des 5. Jahrhunderts organisierten Bischöfe oftmals sogar die Verteidigung ihrer Städte. Dabei konnten sie sich auf das durch Spenden stetig wachsende Vermögen der Kirche sowie auf die Unterstützung des Klerus stützen. Die städtischen Unterschichten, d.h. die Handwerker und Händler, lebten unter schwie rigen Bedingungen und verdienten in der Regel gerade genug für ihren Lebens un ter halt. Schon seit dem 3. Jahrhundert waren sie zwangsweise in staatlich geförderten Vereinigungen organisiert. Um die Versorgung der Städte und der Armee sicherzustellen, wurde die Berufsbindung wichtiger Berufsgruppen eingeführt: Bäcker, Seeleute, Viehund Getreidehändler etwa durften ihren Beruf nicht mehr wechseln und mussten diesen an ihre Söhne weitervererben. Für die Versorgung der Armee wurden zusätzlich Staatsbetriebe eingerichtet, die u.a. Waffen und Kleidung produzierten. Die Stadtbevölkerung Die Kaiser versuchten dem ständigen Rekrutenmangel der römischen Armee entgegenzuwirken, indem sie auch für die Soldaten die Erblichkeit des Berufsstandes einführten. Die Söhne von Soldaten waren gesetzlich zum Dienst in der Armee verpflichtet. Da auch diese Maßnahme nicht ausreichte, um die für die Verteidigung des Reiches notwendige Anzahl von Rekruten zu verpflichten, nahmen die Kaiser stattdessen immer mehr Germanen als gute und billige Söldner in die Armee auf. Für sie war der Dienst in der römischen Armee eine ausgesprochen attraktive Möglichkeit, sich den Lebensunterhalt zu verdienen und im Reich Karriere zu machen. Durch die Aufnahme germanischer Söldner veränderte sich allmählich die Kampfweise der römischen Feldarmee: Die Einheiten waren jetzt kleiner, leichter bewaffnet und taktisch nicht mehr so gut geschult. Auf diese Weise büßte die römische Armee allmählich ihre militärische Überlegenheit ein. Im 4. und 5. Jahrhundert übernahmen zudem regelmäßig Generäle germanischer Herkunft als Heermeister den Oberbefehl über die inzwischen überwiegend aus Germanen bestehende römische Armee. Zeitweise waren diese Heermeister im Westteil des Reiches mächtiger als die gerade regierenden Kaiser und bestimmten dort die Politik. Im 5. Jahrhundert schließlich wurden im Westen ganze germanische Stämme unter eigenen Anführern mit der Kriegsführung für die Römer beauftragt und zu diesem Zweck dauerhaft im Inneren des Reiches angesiedelt. Germanen in der römischen Armee Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
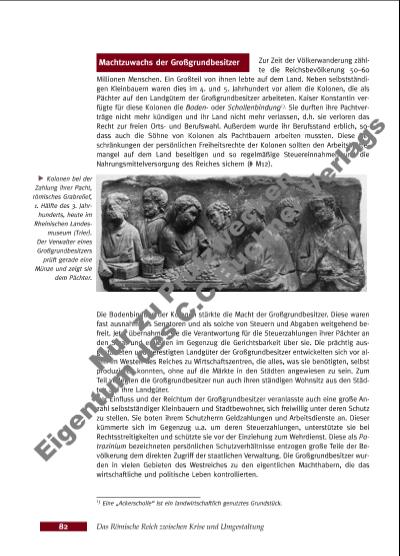 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |