| Volltext anzeigen | |
Was ist das – die „Spätantike“? Der Althistoriker Jochen Martin charakterisiert 2004 die „Spätantike“: „Unter ‚Spätantike’ wird die Zeit zwischen dem Regierungsantritt Diokletians (284) und dem 6. Jahrhundert n. Chr. verstanden. Die Reichskrise des 3. Jahrhunderts bildet insofern die Vorgeschichte der Spätantike, als vieles von dem, was in den Reformen Diokletians und Konstantins systematisch durchgeführt wurde, in ‚Experimenten’ des 3. Jahrhunderts schon angelegt war. Ebenso lässt sich das Ende der Spätantike nicht klar umreißen: Einerseits bildet die Herrschaft Justinians (527–565), der das Römische Reich in seinem alten Umfang noch einmal wiederherzustellen suchte und mit seiner Rechtskodifikation – später als Corpus Iuris Civilis bezeichnet – die gesamte vorangehende Rechtsentwicklung kanonisierte1), einen gewissen Abschluss der römischen Geschichte; andererseits gibt es viele Phänomene, z.B. im Rahmen der Kirchengeschichte, der Geschichte der germanischen Reiche und auch der Organisation der Landwirtschaft, für die die Regierung Justinians keinen Einschnitt bildet. Dennoch lässt sich die Spätantike als historische Formation eigener Art verstehen. Auch wenn die Entgegensetzung von ‚Prinzipat’ und ‚Dominat’ heute nicht mehr in der früheren Form vertreten wird, sind das Kaisertum und die Verwaltung des Reiches seit Diokletian doch signifikant umgestaltet worden. Die germanischen Großstämme bildeten sich im Zusammenspiel mit dem Römischen Reich und in Opposition zu ihm aus. Die Christianisierung des Reiches wurde zum Abschluss gebracht und zugleich wurden z.T. bis heute weiterwirkende Grundlagen für die kirchliche Organisation und die christliche Theologie gelegt. Althistoriker, Mediävisten2), Byzantinisten und Kirchenhistoriker behandeln diese Prozesse, die aber in einem Zusammenhang stehen, sodass z.B. die Ausbildung des Papsttums ohne die Geschichte des spätantiken Kaisertums nicht begriffen werden kann. Die lange gängige Auffassung, die Geschichte der Spätantike sei eine Geschichte des Niedergangs, wird heute zu Recht kaum noch vertreten. Stattdessen spricht man eher von einer ‚Verwandlung’ oder ‚Metamorphose’ der Mittelmeerwelt. Dieses Konzept scheint besser geeignet zu sein, die Janusköpfigkeit3) der Epoche zu erfassen, die zum einen noch der römischen Geschichte zugehört, zum anderen durch die Geburt der germanischen Reiche, des byzantinischen Kaisertums und der mittelalterlichen Kirche charakterisiert ist.“ Jochen Martin, Die Verwandlung der Mittelmeerwelt in der Spätantike, in: Eckhard Wirbelauer (Hrsg.), Antike, München 2004, S. 87–101, hier S. 87 1) hier: zusammenfassen 2) Mediävisten widmen sich der Erforschung des europäischen Mittelalters (z.B. Kunst, Literatur und Geschichte). 3) janusköpfig: sich von zwei entgegengesetzten Seiten zeigend; benannt nach dem doppelgesichtigen römischen Gott Janus Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
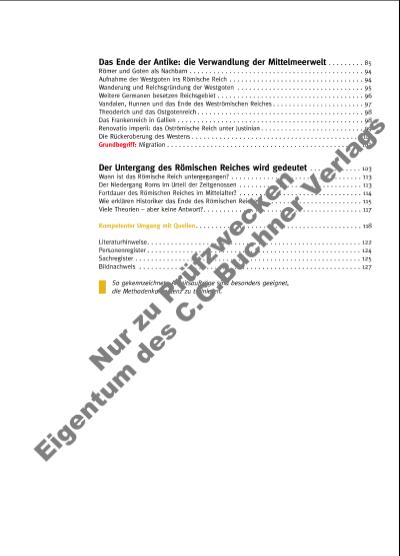 « | 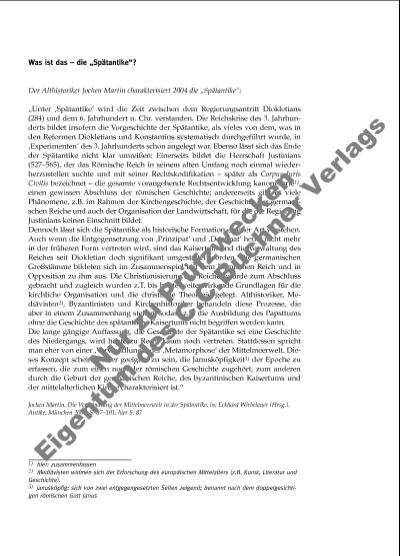 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |