| Volltext anzeigen | |
199Flucht und Vertreibung als Erinnerungsort für die Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen erhalten zu können. Auch später noch sollte der Hinweis auf diese materiellen Belastungen anderen Staaten deutlich machen, dass die Aufnahme von Asylsuchenden aus Europa und anderen Teilen der Welt die Bundesrepublik überfordere. In den Reden bundesdeutscher Politiker und in den medialen Diskussionen der 1950erund 60er-Jahre begannen Flucht und Vertreibung mit dem Vormarsch der Roten Armee über die Reichsgrenzen im Osten. Der Zweite Weltkrieg, die Bedingungen, Formen und Folgen der deutschen Eroberungszüge seit 1939 blieben demgegenüber meist unerwähnt. Und wenn Deutsche mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und mit deutschen Massenmorden konfrontiert wurden, dann sollte der Hinweis auf „Vertreibungsverbrechen“ und auf von Deutschen erlittenes Unrecht relativierend wirken und ein moralisches Gegengewicht bieten. Politische Instrumentalisierungen Im Kontext der politischen Instrumentalisierung der Flüchtlinge und Vertriebenen als Opfer und als Objekte für politische Forderungen blieb wenig Raum für deren persönliche Erinnerungen und Erfahrungen: Erst seit den 1980er-Jahren haben sich mancherlei Initiativen entwickelt, die die biografi sche Dimension ernst nahmen und damit das Handeln von Flüchtlingen und Vertriebenen als Individuen, die ihr Leben gestalteten, Flucht und Vertreibung individuell erinnerten, verarbeiteten, bewältigten und mitteilten. Bis dahin war die persönliche Erinnerung an Flucht und Vertreibung, aber auch an die eigene Geschichte in den Herkunftsgebieten und die individuelle Bindung an eine emotionale Heimat vornehmlich eine private Angelegenheit geblieben. Und kaum jemals in den Fokus der Erinnerungspolitik geriet auch die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen, denen die Aufnahmebevölkerung anfangs nur selten solidarisch, tolerant und hilfsbereit begegnete, sodass Ausgrenzung für die Zuwanderer zum Alltag gehörte. Damit blieb die öffentliche Erinnerung an Flucht und Vertreibung aus politischen Gründen insgesamt ausgesprochen selektiv: Das, woran in der Öffentlichkeit als Flucht und Vertreibung erinnert wurde, hatte durch das Verschweigen der Bezüge zum Zweiten Weltkrieg keine Vorgeschichte und durch das Verschweigen der Probleme der Integration auch keine Folgen. Sie hatte nicht einmal Menschen zum Gegenstand, sondern nur Opfer (u M2). Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung in der DDR und in Ostmittelund Südosteuropa nahm andere Züge an. In der Sowjetischen Besatzungszone und in der frühen DDR waren politische Diskussionen um die neuen Grenzziehungen im Osten und um die ehemaligen deutschen Ostgebiete politisch unerwünscht. Nicht zuletzt deshalb lag es im Bemühen der SED-Führung, keine öffentliche Erinnerung an Flucht und Vertreibung zuzulassen.1 Auch in den Staaten Ostmittelund Südosteuropas gab es über viele Jahrzehnte kein amtliches Interesse an einer Erinnerung an die Zwangsmigration und die vormalige Anwesenheit von Deutschen. i „Die Flucht der Deutschen.“ Titelbild einer Spezialausgabe des Magazins „Der Spiegel“, Nr. 2 von 2002. p Recherchieren Sie verschiedene Formen von Erinnerung zum Thema „Flucht und Vertreibung der Deutschen“. Gestalten Sie dazu ein Plakat. i „Zehn Jahre Vertreibung 1945 1955.“ Sonderbriefmarke der Deutschen Bundespost von 1955. 1 Siehe hierzu ausführlich Seite 194. 32015_1_1_2015_Kap2_138-203.indd 199 01.04.15 10:12 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
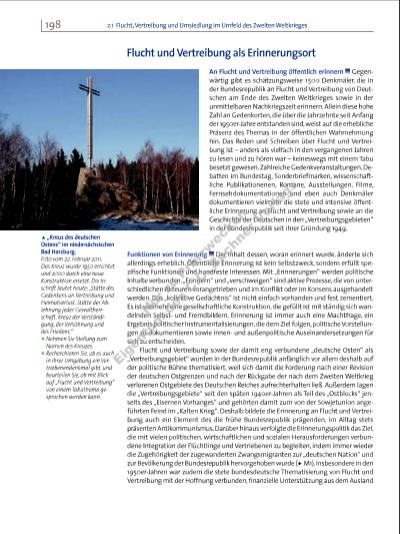 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |