| Volltext anzeigen | |
487 Erwartungshorizont Zu Aufgabe 1 • Der Textauszug stammt aus den Tagebuchaufzeichnungen Friedrich Kellners. Die Quellenform „Tagebuch“ steht für persönliche Authentizität, also Zeitnähe und „Echtheit“, die kritische Haltung Kellners gegenüber dem Nationalsozialismus verbürgt zudem Glaubwürdigkeit. • Friedrich Kellner war ein kleiner Beamter in einer Provinzstadt. Seine Aufzeichnungen zeigen, wie viel der deutsche Normalbürger über die nationalsozialistischen Verbrechen wissen konnte. Sein Wissen basiert auf Quellen, die den meisten anderen Deutschen auch zugänglich waren: Tageszeitung, Radio, zufällig Gehörtes und Gespräche mit Nachbarn, Freunden oder Bekannten, die möglicherweise durch Augenzeugen – etwa von Soldaten auf Fronturlaub – von den Verbrechen in den besetzten Gebieten erfuhren. • Die sich steigernde staatlich organisierte Ausgrenzung der Juden durch diskriminierende Gesetze und Verordnungen war für jedermann ersichtlich („Drangsale ... schlechter als die Tiere gesetzlich behandeln“). Auch die Deportationen fanden öffentlich statt. Wie seine Notizen zeigen, ist es für Kellner im Jahr 1941 nicht nur eine Vermutung, sondern Gewissheit, dass die Unterdrückung in dem „Endziel Ausrottung enden“ wird. • Kellner sieht den deutschen Namen und die deutsche Ehre durch die nationalsozialistischen „Schandtaten“ irreparabel und nachhaltig beschädigt. Er nimmt damit vorweg, was nach Kriegsende Gewissheit war: dass die deutsche Identität stets mit den NS-Verbrechen verbunden sein würde. Der Ehrverlust entsteht für ihn jedoch nicht allein durch die Verbrechen der „Mörderregierung“, sondern vor allem daraus, dass sich die Mehrheit der Deutschen dem Regime beugte, „niemand dem Treiben der Hitler-Banditen Einhalt“ gebot. Kellner selbst wird möglicherweise eine gewisse Entlastung dadurch verspürt haben, dass er – zumindest im Geheimen – die Verbrechen beim Namen nannte. Zu Aufgabe 2 a • Kulka arbeitet aus seinen Quellen vier unterschiedliche Reaktionsweisen auf die Judenverfolgung heraus: Die erste Gruppe akzeptierte die rassistische Diskriminierung grundsätzlich, auch weil sie auf Gesetzen beruhte. Eine zweite Gruppe stellte sich aus politischen, religiösen Gründen oder auch aus Furcht vor Vergeltung gegen die Judenpolitik, vor allem gegen die „wilden Aktionen“. Das Verhalten reichte von Bedenkensäußerungen bis zum Widerstand. Einer dritten Gruppe ging die Judenverfolgung nicht weit genug. Auf der Grundlage der antijüdischen Gesetzgebung versuchte sie selbst, die Verfolgung zu beschleunigen oder zu radikalisieren. Die letzte Gruppe verhielt sich unentschieden und passiv. Gründe dafür werden in den Quellen jedoch nicht genannt. • Auch wenn sich keine Opposition gebildet habe, so stellt Longerich anders als Kulka in den Quellen vor allem Skepsis und Kritik gegenüber der Judenverfolgung fest, die sich mit wachsender Radikalisierung steigerte. Longerich konzentriert sich auf die von Kulka skizzierte vierte Gruppe der „Passiven“, die einen grundsätzlichen „Unwillen“ gegenüber den antijüdischen Maßnahmen erkennen ließ. • Im Gegensatz zu Kulka nennt er mögliche Beweggründe für unangepasstes Verhalten und analysiert dessen Quellenwert: Weil es die „einfachste und risikoloseste“ Form des Widerstandes war, kann sie am ehesten als authentisch und damit als zuverlässig angesehen werden. 32015_1_1_2015_Kap5_470-497.indd 487 01.04.15 10:42 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d s C .C . B uc hn r V er la gs | |
 « | 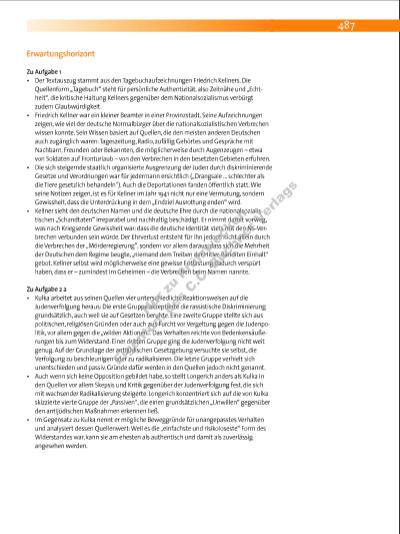 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |