| Volltext anzeigen | |
239Eigennamenverzeichnis chischen (insbesondere philosophischen) Einflüssen gegenüber feindselig eingestellt; warnte die Römer nach dem 2. Punischen Krieg vor einem Wiedererstarken Karthagos und forderte wiederholt die endgültige Zerstörung der Stadt.) (mōns) Caucasus der Kaukasus (Gebirge zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer) (Tib. Iūlius) Celsus (Polemaeānus) Celsus (römischer Senator; nach ihm benannt ist die Celsusbibliothek in Ephesos. Sie bot Platz für rund 12.000 Buchrollen und diente gleichzeitig als Grabmal für den wahrscheinlich 117 n. Chr. Verstorbenen. Sein Sohn stiftete für ihn den Bibliotheksbau und umging damit das in römischer Zeit geltende Gesetz, nach dem Gräber nicht im Stadtgebiet angelegt werden durften.) Celtae, ārum m Pl. die Kelten cēnsor, ōris m Zensor (röm. Beamter; zwei Zensoren, die Konsuln gewesen sein mussten, wurden alle fünf Jahre für eine achtzehnmonatige Amtszeit gewählt. Sie überwachten die öffentliche Sittlichkeit, erstellten das Staatsbudget und führten die Volkszählung auf dem Marsfeld und die Vermögensschätzung durch. Außerdem hatten sie das Recht, Senatoren wegen liederlichen Lebenswandels aus dem Senat auszustoßen (senatu movere). Am Ende ihrer Amtszeit führten sie die feierliche Entsühnung (lustratio) des Volkes durch und opferten den Göttern einen Eber, einen Widder und einen Stier (suovetaurilia). Der bekannteste Träger dieses besonders angesehenen Amtes war der wegen seines strengen Amtsverständnisses gefürchtete Cato Censorius.) Charybdis, is f Charybdis (Strudel, der zusammen mit dem gegenüber hausenden Ungeheuer Skylla die Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland für durchfahrende Schiffe gefährlich machte; als Odysseus ihr auswich, verlor er sechs Männer an Skylla.) Chloë f Chloë (Hirtenmädchen, Geliebte des Daphnis im Roman „Daphnis und Chloë“ des Longos) (M. Tullius) Cicerō, ōnis m Marcus Tullius Cicero (röm. Politiker, Redner, Philosoph und Schriftsteller, 106–43 v. Chr.; während seines Konsulats im Jahr 63 v. Chr. kam es zur Catilinarischen Verschwörung, die von Cicero aufgedeckt und vereitelt wurde. Als Anwalt und Politiker hielt er zahlreiche literarisch bedeutsame Reden, die erhalten sind (u. a. 4 Reden „In Catilinam“, 10 Reden „In Marcum Antonium“). Er stellte durch mehrere Schriften die röm. Beredsamkeit auf ein breites theoretisches Fundament (u. a. „De oratore“). Er vermittelte den Römern durch seine philosophischen Schriften die griech. Philosophie (u. a. „Tusculanae disputationes“, „De re publica“, „De officiis“, „De finibus bonorum et malorum“, De natura deorum“). Bedeutend als historische Quelle ist auch die Sammlung seiner Briefe an Familienangehörige und Freunde (u. a. „Epistulae ad familiares“). Das Latein Ciceros gilt als Höhepunkt der klassischen röm. Kunstprosa. Cicero war ein entschiedener Befürworter der alten röm. Republik und geriet daher in Konflikt mit Cäsar und Marcus Antonius; auf Betreiben des Letzteren wurde Cicero ermordet.) Cimbrī, ōrum m Pl. die Kimbern (nordgermanischer Volksstamm, fiel um 115 v. Chr. in Gallien und Italien ein; wurde 101 v. Chr. von den Römern unter der Führung des Konsuls Gaius Marius in Norditalien vernichtend geschlagen) Circē, ēs f Kirke (Nymphe und Zauberin auf der Insel Aea, wo Odysseus und seine Gefährten strandeten; diese verwandelte Kirke in Schweine; auf Drängen des Odysseus, in den sie sich verliebt hatte, machte sie die Verwandlung jedoch rückgängig.) Circus Maximus Circus Maximus (größte Rennbahn Roms zwischen den Hügeln Palatin und Aventin, angeblich bereits im 6. Jh. v. Chr. erbaut, später von Cäsar erneuert) (Claudius) Claudiānus Claudian (letzter bedeutender Dichter des heidnischen Rom, aus Alexandria, um 400 n. Chr. Neben zahlreichen Gedichten verfasste er das Epos „De raptu Proserpinae“, darüber hinaus Lobreden auf den Kaiser und eine Preisschrift auf den Feldherrn Stilicho.) Cleopatra Kleopatra VII. (letzte Königin Ägyptens von 51–30 v. Chr.; war von ihrem Bruder und Mitregenten Ptolemaios XIII. verstoßen; wurde aber von Cäsar, den die Verfolgung des Pompejus nach Ägypten geführt hatte, wieder eingesetzt. Kleopatra hatte zuerst ein Verhältnis mit Cäsar, dann mit Antonius; 31 v. Chr. unterlagen sie und Antonius dem Heer des Oktavian/Augustus bei Aktium, beide begingen daraufhin Selbstmord.) Clōdia Clodia (bekannte römische Patrizierin, deren Lebenswandel von Cicero attackiert wurde, um ihren politischen Einfluss zu schwächen) (L. Tarquinius) Collātīnus Lucius Tarquinius Collatinus (Ehemann der Lukretia, die von Sextus Tarquinius vergewaltigt wurde, was die Vertreibung der Tarquinier aus Rom auslöste) Colōnia Agrippīna Köln (55 n. Chr. von Kaiser Nero gegründet, benannt nach Agrippina, der Mutter des Kaisers; entwickelte sich neben Trier zur wichtigsten röm. Stadt in Germanien) (Flāvius Valerius) Cōnstantīnus Konstantin der Große (röm. Kaiser von 306–337 n. Chr.; gründete 330 v. Chr. das alte Byzanz unter den Namen Konstantinopel neu und erhob es zur Hauptstadt des röm. Reiches. 313 n. Chr. erließ er in Mailand ein Edikt zum Schutz der Christen.) cōnsul, cōnsulis m Konsul (röm. Beamter; mit dem 43. Lebensjahr konnte das Konsulat, das höchste zivile und militärische Amt, ausgeübt werden. Dieses war für eine einjährige Amtszeit auf zwei Konsuln aufgeteilt. Jeder Konsul konnte die Beschlüsse und Maßnahmen des jeweils anderen durch sein Veto behindern. In Rom lösten die Konsuln einander monatlich im Senatsvorsitz ab, im Krieg wechselte sogar täglich der Oberbefehl. Sie standen den Senatssitzungen vor, brachten Gesetzesanträge ein und überwachten die Durchführung der Beschlüsse und Gesetze. Außerdem hatten sie die auspicia (Feststellung des Willens der Götter durch Vogelschau etc.), die Einweihung von Tempeln und die Nu zu Pr üf zw ec k n Ei g nt um de C .C .B uc hn r V la gs | |
 « | 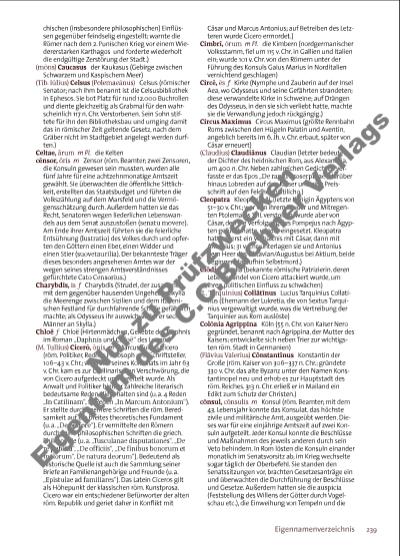 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |