| Volltext anzeigen | |
243Eigennamenverzeichnis Lāius Lajos (König von Theben, Vater des Ödipus, wurde von seinem Sohn, der ihn nicht erkannt hatte, im Affekt erschlagen) Lāocoōn, Lāocoontis m Laokoon (trojanischer Priester; warnte die Trojaner vergeblich vor dem hölzernen Pferd der Griechen; er und seine beiden Söhne wurden daraufhin auf Geheiß Apollons, der auf Seiten der Griechen stand, von zwei Seeschlangen erwürgt.) Larēs, um m Pl. die Laren (röm. Gottheiten, die Haus und Familie beschützten) Latīnus, a, um lateinisch („latinisch“, nach der Landschaft Latium und dem Stamm der Latiner, die in Mittelitalien siedelten) līctor, ōris m Liktor (Amtsdiener, die höheren röm. Beamten und Priestern voranschritten; sie trugen als Zeichen der Amtsgewalt ein Rutenbündel mit Beil (fasces) auf der linken Schulter. Dieses symbolisierte das Recht des Beamten, Verhaftungen, Strafen – in früherer Zeit auch Hinrichtungen – anzuordnen. Die Liktoren hatten die Aufgabe, die Ankunft des Beamten anzukündigen und ihm einen Weg durch die Menge zu bahnen, nur Vestalinnen und verheiratete Römerinnen brauchten ihm nicht Platz zu machen. Ein Diktator hatte 24 Liktoren, ein Konsul 12, Prätoren 6 bei sich.) līmes, līmitis m der Limes (von Kaiser Domitian seit 84 n. Chr. erbauter Grenzwall, trennt das römische Reich von Germanien ab; verläuft vom Rhein bei Bonn südöstlich durch Württemberg und Bayern bis an die Donau bei Regensburg; wurde im 3. Jh. im Zuge der Völkerwanderung von den Germanen durchbrochen.) (T.) Līvius Livius (röm. Geschichtsschreiber, 59 v. Chr.– 17 n. Chr.; beschrieb die Geschichte Roms – von der Gründung Roms bis auf die eigene Zeit – in seinem 142 Bücher umfassenden Werk „Ab urbe condita“. Livius will nicht nur die Taten und die Größe Roms aufzeigen, sondern auch den Niedergang der Sitten, der für die politischen Wirren des 1. Jh.s v. Chr. verantwortlich war: Der Leser soll aus der Geschichte lernen.) Lombardus lombardisch, Lombarde (Die Lombardei ist eine Landschaft in Norditalien.) Lucrētia Lukretia (Frau des Collatinus; wurde von Sextus Tarquinius vergewaltigt, was die Vertreibung der Tarquinier als Herrscher von Rom nach sich zog) (T.) Lucrētius (Cārus) Lukrez (röm. Schriftsteller und Philosoph, 98–55 v. Chr.; verfasste das Lehrgedicht „De rerum natura“ in 6 Büchern. Lukrez stellt in Versform die Lehren der epikureischen Naturphilosophie dar. Als Jünger Epikurs will er seine röm. Landsleute von der Religion, d.h. für ihn von der Götterund Todesfurcht, befreien durch die Erkenntnis, dass alles natürlich, alles vergänglich ist (Atomtheorie).) (L. Licinius) Lūcullus Lukull (röm. Feldherr in Kleinasien um 70 v. Chr.; sorgte dort nach seinem militärischen Sieg für geordnete Verhältnisse im Finanzwesen und in der Provinzverwaltung; sein Reichtum und sein exquisiter Geschmack sind sprichwörtlich.) Lūna Luna (röm. Mondgöttin, Schwester des Sonnengottes Sol) Lydī, ōrum m Pl. die Lyder (Einwohner von Lydien im westlichen Kleinasien) Macedōnia Makedonien (Landschaft im Norden Griechenlands; wurde 148 v. Chr. röm. Provinz) (T.) Mānlius Torquātus Titus Manlius Torquatus (Konsul 340 v. Chr., zusammen mit P. Decius Mus besiegte er die Latiner.) Marcus Aurēlius Mark Aurel (röm. Kaiser 16–180 n. Chr. Seine Regierungszeit war geprägt durch zahlreiche Feldzüge, die er zur Sicherung des Reiches an allen wichtigen Grenzen unternehmen musste, insbesondere zur Abwendung der immer bedrohlicher werdenden Germanenstämme; Mark Aurel war zugleich (stoischer) Philosoph und Verfasser der „Selbstbetrachtungen“, einer moralphilosophischen Schrift in griech. Sprache. Die Schrift lässt den Kaiser als einen enttäuschten, mutlosen Menschen erkennen, der um innere Stärke gegen die Furcht vor dem Tode, die Sorgen dieser Welt und die Ungerechtigkeiten seiner Mitmenschen ringt.) Mārs, Mārtis m Mars (röm. Gott des Krieges; griech. Name: Ares) (M. Valerius) Mārtiālis m Martial (röm. Dichter, ca. 40–98 n. Chr., verfasste hauptsächlich Spottgedichte in Form von Epigrammen.) Mausōlus Mausolos (persischer Herrscher von 377– 353 v. Chr. im kleinasiatischen Karien mit der Hauptstadt Halikarnass; seine Frau Artemisia ließ ihm nach seinem Tod ein prächtiges Grabmal bauen, ein „Mausoleum“.) Medūsa Medusa (weibliches Ungeheuer mit Schlangenhaaren) Menander, drī Menander (griech. Komödiendichter, ca. 342–292 v. Chr.; Vorbild für die röm. Komödiendichter) Menelāus Menelaos (König von Sparta, Ehemann der von Paris geraubten schönen Helena) Menēnius Agrippa Menenius Agrippa (Patrizier, der zur Zeit der Ständekämpfe mit diplomatischem Geschick die aus Rom ausgewanderten Plebejer wieder nach Rom zurückholte) Mercurius Merkur (Götterbote, Gott des Handels, der Reise und der Diebe, griech. Name: Hermes) Mīlētus f Milet (Hafenstadt in der kleinasiatischen Landschaft Karien; Geburtsort des Philosophen Thales) Minucius Fēlix Minucius Felix (lat. Kirchenschriftsteller aus Rom, 3. Jh. n. Chr.) Minerva Minerva (Göttin der Weisheit und des Handwerks; griech. Name: Athene) Mithrās, ae m Mithras (persischer Lichtgott, im 1. Jh. v. Chr. gelangte sein Kult, dessen geheime Riten ausschließlich Männern vorbehalten waren, auch nach Rom. Hier wurde er mit dem Sonnengott gleichgesetzt. Mit den röm. Soldaten gelangte der Mithraskult in alle Provinzen, wo er sich mit den Landesreligionen vermischte.) Mōgontiācum Mainz (Die Stadt gehört zu den ältesten Siedlungen am Rhein. Auf dem Platz einer keltischen Siedlung legten die Römer um 38 v. Chr. ein befestigtes Lager an. Mogontiacum wurde zur Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d C .C .B uc hn er V rla gs | |
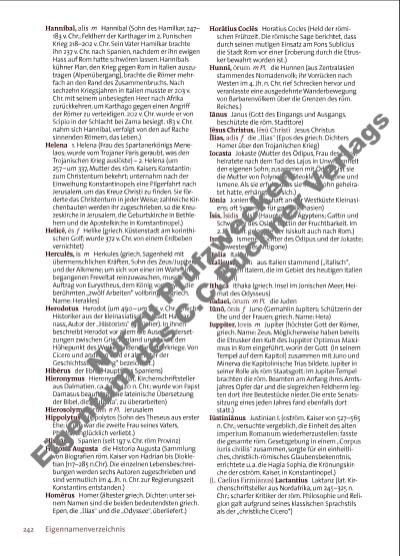 « | 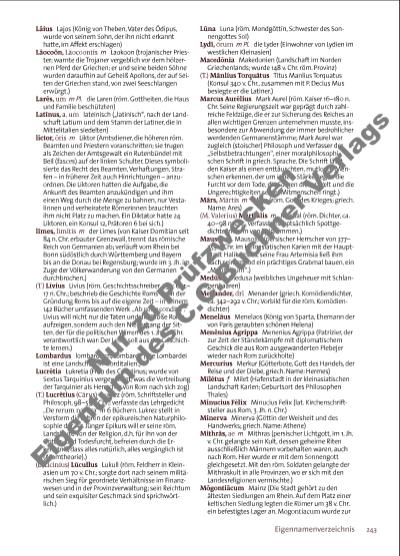 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |