| Volltext anzeigen | |
193Sprachgebrauch und Sprachreflexion: Wort und Stil Zwischen Inszenierung und Information a) Untersuche die folgenden Formulierungen und überlege, welche Absicht dahintersteckt: Freisetzung für Entlassung • Schadgut für Giftmüll • Bankenrettung für aus Steuergeldern finanzierte staatliche Maßnahmen zur Abwendung einer Bankenpleite • Minuswachstum für Rückgang b) Schlage nach, was mit den folgenden Begriffen gemeint ist, und erkläre, warum sie deiner Meinung nach ein Unwort sind. Lies dazu den folgenden Merkkasten. Wohlstandsmüll • Überfremdung • Humankapital • alternativlos • ethnische Säuberung • Gewinnwarnung • Menschenmaterial • Rentnerschwemme • notleidende Banken 8. Untersuche, in welche Richtung bei den folgenden Beispielen das Denken durch bestimmte positive Bezeichnungen gelenkt werden soll: Raumpflegerin statt Putzfrau • Förderschule statt Sonderschule • Freiheitskämpfer statt Terrorist • Wildkraut statt Unkraut • Greifvogel statt Raubvogel • Freitod statt Selbstmord 9. Ihr wisst sicher, dass man nicht mehr Neger sagt. Auch die Bezeichnungen Zigeuner und Eskimo sind in Verruf geraten. Tauscht euer Wissen aus: Warum ist das so? Was sagt man stattdessen? • Unwörter: Da Sprache und Denken eng zusammenhängen, – kann Sprache das Denken einer Person entlarven, z.B. ein negatives Menschenbild spiegeln, – kann Sprache verwendet werden, um das Denken anderer zu manipulieren, z.B. indem schlimme Sachverhalte harmlos oder positiv erscheinen. In beiden Fällen spricht man von „Unwörtern“. • Sprachkritik betreibt, wer die negativen Ansichten und Absichten aufzeigt, die sich hinter bestimmten Sprachverwendungen verbergen. • Sprachpflege betreibt, wer sich um einen korrekten und respektvollen Sprachgebrauch bemüht. „Political Correctness“ (PC) / „Politisch korrekter“ Sprachgebrauch: • An die Stelle von Bezeichnungen, die als diskriminierend (herabsetzend) empfunden werden oder die bestimmte Gruppen ausgrenzen, werden bessere Formulierungen gesetzt. • Die Bewegung der „PC“ nahm in den USA der späten 80er Jahre ihren Anfang. • Sie bezog sich dort vor allem auf die Achtung von Minderheiten und die Gleichberechtigung der Frau. In diesem Punkt spricht man von genderoder geschlechtergerechter Sprache. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
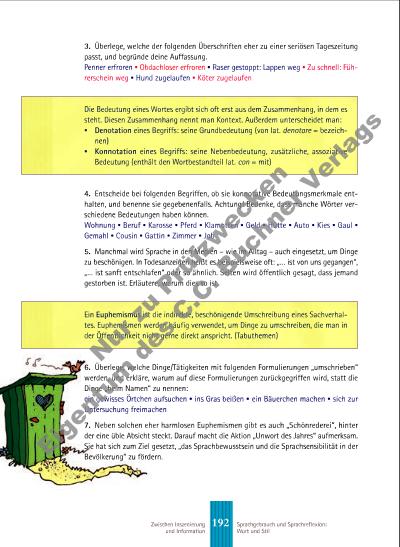 « | 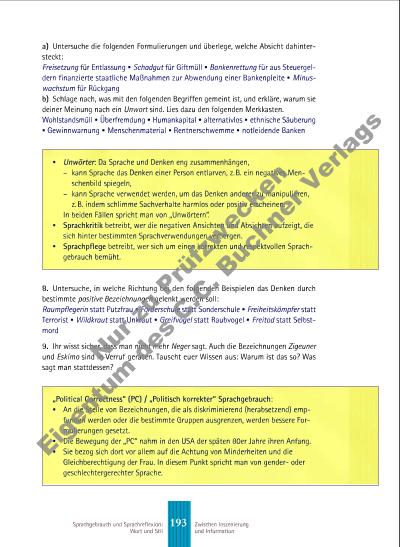 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |